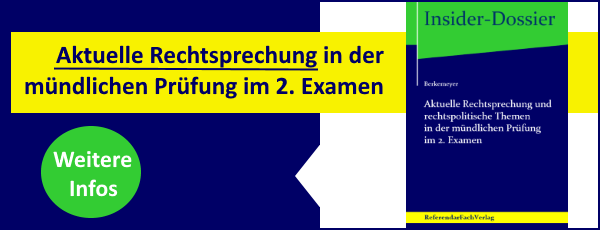11.02.2025, 13:58
(11.02.2025, 13:33)Paulaner schrieb: Geschützte Berufe, wie der des Anwalts oder Arztes, sind sicher vor KI. Unser Berufsstand hat eine starke Lobby, die sicherstellen wird, dass das Geld weiter fliesst. Zuerst geht es den anderen Büroarbeitern in der freien Wirtschaft, den BWLern, Ingenieuren und Informatikern, an den Kragen.
so falsch wie die übergroße Besorgnis bei diesem Thema ist, so naiv ist diese Ansicht
KI wird etwas verändern und das wird die Lobby nicht für uns Juristen abfedern
11.02.2025, 14:21
Dass sich etwas verändern wird, ist zu erwarten. Es ist allerdings nicht zu befürchten, dass sich etwas zu unseren Ungunsten ändern wird.
11.02.2025, 15:04
(11.02.2025, 13:33)Paulaner schrieb: Geschützte Berufe, wie der des Anwalts oder Arztes, sind sicher vor KI. Unser Berufsstand hat eine starke Lobby, die sicherstellen wird, dass das Geld weiter fliesst. Zuerst geht es den anderen Büroarbeitern in der freien Wirtschaft, den BWLern, Ingenieuren und Informatikern, an den Kragen.
Es geht doch insb darum, wie viele Juristen man noch benötigt. Ein geschützter Berufsstand hilft auch nicht, wenn mit weniger Personal sogar ein Mehr an Akten abgearbeitet werden kann bzw das Unternehmen durch KI-Einsatz weniger extern mandatieren muss, oder einfach weniger Rechtsberatungsbedarf im Zuge der KI-Entwicklung besteht usw usf.
Außerdem arbeiten viele nicht als RA, sondern in iwelchen Unternehmen, Stiftungen, Verbänden, ÖD oder Versicherungen (nicht selten auch in sog "Bullshitjobs"... zumindest objektiv...jeder wird natürlich seinen eigene Arbeitsleistung bzw die ausgeübte Tätigkeit, als besonders wichtig und nicht ersetzbar erachten).
Die mangelnde Digitalisierung war auch immer eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Juristen.
11.02.2025, 16:35
(11.02.2025, 13:33)Paulaner schrieb: Geschützte Berufe, wie der des Anwalts oder Arztes, sind sicher vor KI. Unser Berufsstand hat eine starke Lobby, die sicherstellen wird, dass das Geld weiter fliesst. Zuerst geht es den anderen Büroarbeitern in der freien Wirtschaft, den BWLern, Ingenieuren und Informatikern, an den Kragen.
Anwälte und starke Lobby




Schreib dem Finanzamt mal mit deinem beA oder schau die historischen Erhöhungen des RVG an.
11.02.2025, 16:58
(11.02.2025, 15:04)nachdenklich schrieb:(11.02.2025, 13:33)Paulaner schrieb: Geschützte Berufe, wie der des Anwalts oder Arztes, sind sicher vor KI. Unser Berufsstand hat eine starke Lobby, die sicherstellen wird, dass das Geld weiter fliesst. Zuerst geht es den anderen Büroarbeitern in der freien Wirtschaft, den BWLern, Ingenieuren und Informatikern, an den Kragen.
Es geht doch insb darum, wie viele Juristen man noch benötigt. Ein geschützter Berufsstand hilft auch nicht, wenn mit weniger Personal sogar ein Mehr an Akten abgearbeitet werden kann bzw das Unternehmen durch KI-Einsatz weniger extern mandatieren muss, oder einfach weniger Rechtsberatungsbedarf im Zuge der KI-Entwicklung besteht usw usf.
Lass mal zwei Jahre lang den Sales die Verträge mittels KI draften. Danach brauchst du doppelt so viele Juristen wie davor, weil Sales die KI solange prügelt, bis diese die Klauseln ausspuckt, die sie haben wollen - egal, ob das in irgendeiner Weise sinnvoll ist, im Gesamtkontext stimmig oder rechtssicher.
11.02.2025, 18:19
(11.02.2025, 16:58)Patenter Gast schrieb:(11.02.2025, 15:04)nachdenklich schrieb:(11.02.2025, 13:33)Paulaner schrieb: Geschützte Berufe, wie der des Anwalts oder Arztes, sind sicher vor KI. Unser Berufsstand hat eine starke Lobby, die sicherstellen wird, dass das Geld weiter fliesst. Zuerst geht es den anderen Büroarbeitern in der freien Wirtschaft, den BWLern, Ingenieuren und Informatikern, an den Kragen.
Es geht doch insb darum, wie viele Juristen man noch benötigt. Ein geschützter Berufsstand hilft auch nicht, wenn mit weniger Personal sogar ein Mehr an Akten abgearbeitet werden kann bzw das Unternehmen durch KI-Einsatz weniger extern mandatieren muss, oder einfach weniger Rechtsberatungsbedarf im Zuge der KI-Entwicklung besteht usw usf.
Lass mal zwei Jahre lang den Sales die Verträge mittels KI draften. Danach brauchst du doppelt so viele Juristen wie davor, weil Sales die KI solange prügelt, bis diese die Klauseln ausspuckt, die sie haben wollen - egal, ob das in irgendeiner Weise sinnvoll ist, im Gesamtkontext stimmig oder rechtssicher.
+1 du hast offensichtlich Erfahrung mit den Gesellen :D
13.02.2025, 09:33
(11.02.2025, 16:58)Patenter Gast schrieb::-D auf den Punkt(11.02.2025, 15:04)nachdenklich schrieb:(11.02.2025, 13:33)Paulaner schrieb: Geschützte Berufe, wie der des Anwalts oder Arztes, sind sicher vor KI. Unser Berufsstand hat eine starke Lobby, die sicherstellen wird, dass das Geld weiter fliesst. Zuerst geht es den anderen Büroarbeitern in der freien Wirtschaft, den BWLern, Ingenieuren und Informatikern, an den Kragen.
Es geht doch insb darum, wie viele Juristen man noch benötigt. Ein geschützter Berufsstand hilft auch nicht, wenn mit weniger Personal sogar ein Mehr an Akten abgearbeitet werden kann bzw das Unternehmen durch KI-Einsatz weniger extern mandatieren muss, oder einfach weniger Rechtsberatungsbedarf im Zuge der KI-Entwicklung besteht usw usf.
Lass mal zwei Jahre lang den Sales die Verträge mittels KI draften. Danach brauchst du doppelt so viele Juristen wie davor, weil Sales die KI solange prügelt, bis diese die Klauseln ausspuckt, die sie haben wollen - egal, ob das in irgendeiner Weise sinnvoll ist, im Gesamtkontext stimmig oder rechtssicher.
14.02.2025, 15:16
Praxisbeispiel einer KI-Lösung zu einem Aktenvortrag, der kürzlich in NRW lief. Wir haben das mal probiert, weil CryptoKraut oben beschrieb, dass das KI-Ergebnis bei einer Probeexamensklausurs sehr gut ausfiel:
Sachverhalt
Es handelte sich um einen Aktenvortrag auf richterlicher Sicht. Klage erhoben hat eine Privatperson aus Duisburg gegen ein Autohaus mit Sitz in Dinslaken als GmbH. Der Kläger hat in seinem Schreiben angekündigt, zu beantragen, den Beklagten auf Rückzahlung des Kaufpreises für einen Tesla mit Luxusausstattung Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs zu verurteilen.
Der Kläger kaufte den Wagen nach Besichtigung und Probefahrt im Autohaus. Nach einigen Urlauben und Aufenthalten im Ausland und weniger als ein Jahr nach dem Kauf zeigte der Wagen Ausfallerscheinungen. So blieb er plötzlich stehen, die Lampen leuchteten auf und das Kfz war erst nach einiger Zeit wieder betriebsbereit. Daraufhin forderte der Kläger die Beklagte (also das Autohaus) auf, den Wagen zu reparieren, was diese verweigerte. Dann erklärte der Kläger mehrmals mit Schreiben den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte die Beklagte auf, den Wagen zurückzunehmen und den Kaufpreis – abzüglich eines Betrags für die gefahrenen Kilometer (Stichwort Nutzungen) – zurückzuzahlen, was diese jedoch verweigerte. Sie reagierte nicht auf die mehreren Schriftsätze des Klägers.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Sie wendete zum einen ein, der Kläger habe sich zunächst an den Hersteller zu wenden. Dieser habe eine sog. Herstellergarantie gegeben, die sie – die Beklagte – dem Kläger auch bei Vertragsschluss übergeben habe. Sie – die Beklagte – hafte grundsätzlich nicht für Schäden wegen der bestehenden Herstellergarantie. Es könne nicht sein, dass sie als Vertragspartnerin jetzt trotz der bestehenden Garantie in Anspruch genommen werde. Das würde den Sinn der Garantie vollkommen ad absurdum führen. Darüber hinaus habe der Kläger vom geforderten Kaufpreis eine Summe in Höhe von 6.000 EUR abzuziehen, denn er habe eine sog. Umweltprämie beantragt und auch erhalten. Diese solle aber den Verkäufern zugute kommen und letztlich den Käufern als Kaufanreiz dienen. Deshalb könne er – der Kläger – die beantragte Prämie nicht einfach einbehalten, sondern habe sie abzurechnen, also vom Kaufpreis im Rahmen der Rückabwicklung abzuziehen.
Abgedruckt – also in der Akte befindlich – war zwar nicht der Kaufvertrag mit dem Passus der Herstellergarantie, aber die Vorschriften des Amtes für Umwelt (… der genaue Name ist mir leider entfallen) über die Gewährung der Umweltprämie. Darin war unter anderem zu lesen, dass der „Käufer“ die Umweltprämie beantragen könne. Er habe das Fahrzeug dann sechs Monate zu nutzen, ansonsten müsse er (also der Käufer) die Prämie zurückzahlen.
Darüber hinaus war das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Duisburg abgedruckt. Darin hieß es, der klägerische Anwalt habe vorgetragen, sein Mandant sei mittlerweile weitere Strecken mit dem Auto gefahren, weshalb sich der Betrag für den Nutzungsersatz noch einmal erhöht habe. Dieser Betrag sei von dem sowieso schon heruntergesetzten Kaufpreis abzuziehen und insofern erkläre er die Klage für erledigt (entsprechend anders als in der Klageschrift lautete dann auch sein Antrag). Der Vertreter der Beklagten hingegen stimmte dem ausdrücklich nicht zu, sondern beantragte vielmehr (wie auch in seinem Schriftsatz), die Klage abzuweisen.
Die Aufgabe war es nun, die Entscheidung des Gerichts vorzuschlagen, wobei die Rechtsbehelfsbelehrung erlassen war. Das heißt, neben der Hauptentscheidung waren auch die Nebenentscheidungen (also die über die Kosten und die vorläufige Vollstreckbarkeit) darzustellen.
Lösung ChatGPT
Entscheidung des Gerichts:
1. Hauptentscheidung:
Die Klage wird abgewiesen.
Begründung:
Das Gericht stellt fest, dass der Kläger zunächst die Herstellergarantie des Herstellers in Anspruch nehmen muss, bevor er Ansprüche gegen das Autohaus geltend machen kann. Die Beklagte hat nachweislich die Herstellergarantie dem Kläger bei Vertragsschluss übergeben, und es ist nicht gerechtfertigt, dass die Beklagte für Mängel haftet, die unter diese Garantie fallen. Zudem hat der Kläger die Umweltprämie in Höhe von 6.000 EUR erhalten, die er im Rahmen der Rückabwicklung vom Kaufpreis abziehen muss. Der Kläger hat auch nicht nachgewiesen, dass er die Prämie zurückzahlen müsste, da er das Fahrzeug die erforderlichen sechs Monate genutzt hat.
2. Nebenentscheidungen:
a) Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger.
b) Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung wird angeordnet.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist bei dem zuständigen Oberlandesgericht einzureichen.
Lösung Gemini 2.0 Flash
Tatbestand
(Die Darstellung des Tatbestands orientiert sich an Ihrer Schilderung und fasst die wesentlichen Punkte zusammen. Hier werden keine Namen genannt, um die Vorlage flexibel zu halten.)
Der Kläger begehrt von der Beklagten die Rückzahlung des Kaufpreises für einen gebrauchten Tesla mit Luxusausstattung, Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs.
Der Kläger erwarb das Fahrzeug nach Besichtigung und Probefahrt im Autohaus der Beklagten. Innerhalb eines Jahres nach dem Kauf traten Ausfallerscheinungen auf, die den Kläger zur Aufforderung zur Reparatur veranlassten. Die Beklagte lehnte eine Reparatur ab. Der Kläger erklärte daraufhin den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte die Beklagte zur Rücknahme des Fahrzeugs und zur Rückzahlung des Kaufpreises, abzüglich einer Nutzungsentschädigung, auf. Die Beklagte reagierte nicht.
Der Kläger hat zunächst beantragt, die Beklagte zur Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs zu verurteilen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Duisburg hat der Kläger, unter Berücksichtigung weiterer gefahrener Strecken und einer entsprechenden Erhöhung des Nutzungsersatzes, die Klage für erledigt erklärt und einen entsprechenden geänderten Antrag angekündigt.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie beruft sich auf eine Herstellergarantie und darauf, dass der Kläger die ihm gewährte Umweltprämie in Höhe von 6.000 EUR bei der Rückabwicklung anrechnen lassen müsse. Sie hat der Erledigungserklärung des Klägers widersprochen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom [Datum der mündlichen Verhandlung] Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.
I. Zulässigkeit
Die Klage ist zulässig. Das Landgericht Duisburg ist gemäß § 29 ZPO zuständig, da sich der Erfüllungsort des Kaufvertrags, nämlich das Autohaus der Beklagten, im Bezirk des Landgerichts Duisburg befindet. Auch im Übrigen bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Klage.
II. Begründetheit
Die Klage ist jedoch unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs aus §§ 437 Nr. 2, 434, 440, 323, 346 BGB.
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung an das Oberlandesgericht [Name des Oberlandesgerichts] zulässig, wenn der Beschwerdewert 600,-€ übersteigt oder die Berufung durch das Landgericht zugelassen wurde. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Urteils beim Oberlandesgericht [Name des Oberlandesgerichts], [Adresse des Oberlandesgerichts], eingelegt und begründet werden.
Ergebnis: Gemini Flash 2.0 schreibt ein ausführlicheres Gutachten bzw. ausführlicheren Entscheidungsentwurf als ChatGPT, was sich mehr nach einer juristischen Lösung anhört. Der an sich nicht schwierige Fall wird aber von beiden KIs weitestgehend falsch gelöst.
Natürlich kann man nun einwenden, dass man den Prompt besser schreiben muss, damit dann die KI den Sachverhalt besser erfasst und so zur richtigen Lösung kommt. Dann brauche ich aber dann doch wieder einen Juristen, der das übernimmt. Als Betroffener ohne Rechtskenntnisse kann ich das nicht.
Stand jetzt lösen offenbar KI auch recht einfache Fälle wie den oben geschilderten Fall mal richtig und mal falsch. Daher also nicht verlässlich und somit faktisch unbrauchbar. Wir wollen aber natürlich nicht ausschließen, dass sich das noch in der Zukunft ändert.
Sachverhalt
Es handelte sich um einen Aktenvortrag auf richterlicher Sicht. Klage erhoben hat eine Privatperson aus Duisburg gegen ein Autohaus mit Sitz in Dinslaken als GmbH. Der Kläger hat in seinem Schreiben angekündigt, zu beantragen, den Beklagten auf Rückzahlung des Kaufpreises für einen Tesla mit Luxusausstattung Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs zu verurteilen.
Der Kläger kaufte den Wagen nach Besichtigung und Probefahrt im Autohaus. Nach einigen Urlauben und Aufenthalten im Ausland und weniger als ein Jahr nach dem Kauf zeigte der Wagen Ausfallerscheinungen. So blieb er plötzlich stehen, die Lampen leuchteten auf und das Kfz war erst nach einiger Zeit wieder betriebsbereit. Daraufhin forderte der Kläger die Beklagte (also das Autohaus) auf, den Wagen zu reparieren, was diese verweigerte. Dann erklärte der Kläger mehrmals mit Schreiben den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte die Beklagte auf, den Wagen zurückzunehmen und den Kaufpreis – abzüglich eines Betrags für die gefahrenen Kilometer (Stichwort Nutzungen) – zurückzuzahlen, was diese jedoch verweigerte. Sie reagierte nicht auf die mehreren Schriftsätze des Klägers.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Sie wendete zum einen ein, der Kläger habe sich zunächst an den Hersteller zu wenden. Dieser habe eine sog. Herstellergarantie gegeben, die sie – die Beklagte – dem Kläger auch bei Vertragsschluss übergeben habe. Sie – die Beklagte – hafte grundsätzlich nicht für Schäden wegen der bestehenden Herstellergarantie. Es könne nicht sein, dass sie als Vertragspartnerin jetzt trotz der bestehenden Garantie in Anspruch genommen werde. Das würde den Sinn der Garantie vollkommen ad absurdum führen. Darüber hinaus habe der Kläger vom geforderten Kaufpreis eine Summe in Höhe von 6.000 EUR abzuziehen, denn er habe eine sog. Umweltprämie beantragt und auch erhalten. Diese solle aber den Verkäufern zugute kommen und letztlich den Käufern als Kaufanreiz dienen. Deshalb könne er – der Kläger – die beantragte Prämie nicht einfach einbehalten, sondern habe sie abzurechnen, also vom Kaufpreis im Rahmen der Rückabwicklung abzuziehen.
Abgedruckt – also in der Akte befindlich – war zwar nicht der Kaufvertrag mit dem Passus der Herstellergarantie, aber die Vorschriften des Amtes für Umwelt (… der genaue Name ist mir leider entfallen) über die Gewährung der Umweltprämie. Darin war unter anderem zu lesen, dass der „Käufer“ die Umweltprämie beantragen könne. Er habe das Fahrzeug dann sechs Monate zu nutzen, ansonsten müsse er (also der Käufer) die Prämie zurückzahlen.
Darüber hinaus war das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Duisburg abgedruckt. Darin hieß es, der klägerische Anwalt habe vorgetragen, sein Mandant sei mittlerweile weitere Strecken mit dem Auto gefahren, weshalb sich der Betrag für den Nutzungsersatz noch einmal erhöht habe. Dieser Betrag sei von dem sowieso schon heruntergesetzten Kaufpreis abzuziehen und insofern erkläre er die Klage für erledigt (entsprechend anders als in der Klageschrift lautete dann auch sein Antrag). Der Vertreter der Beklagten hingegen stimmte dem ausdrücklich nicht zu, sondern beantragte vielmehr (wie auch in seinem Schriftsatz), die Klage abzuweisen.
Die Aufgabe war es nun, die Entscheidung des Gerichts vorzuschlagen, wobei die Rechtsbehelfsbelehrung erlassen war. Das heißt, neben der Hauptentscheidung waren auch die Nebenentscheidungen (also die über die Kosten und die vorläufige Vollstreckbarkeit) darzustellen.
Lösung ChatGPT
Entscheidung des Gerichts:
1. Hauptentscheidung:
Die Klage wird abgewiesen.
Begründung:
Das Gericht stellt fest, dass der Kläger zunächst die Herstellergarantie des Herstellers in Anspruch nehmen muss, bevor er Ansprüche gegen das Autohaus geltend machen kann. Die Beklagte hat nachweislich die Herstellergarantie dem Kläger bei Vertragsschluss übergeben, und es ist nicht gerechtfertigt, dass die Beklagte für Mängel haftet, die unter diese Garantie fallen. Zudem hat der Kläger die Umweltprämie in Höhe von 6.000 EUR erhalten, die er im Rahmen der Rückabwicklung vom Kaufpreis abziehen muss. Der Kläger hat auch nicht nachgewiesen, dass er die Prämie zurückzahlen müsste, da er das Fahrzeug die erforderlichen sechs Monate genutzt hat.
2. Nebenentscheidungen:
a) Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger.
b) Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung wird angeordnet.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist bei dem zuständigen Oberlandesgericht einzureichen.
Lösung Gemini 2.0 Flash
- Die Klage wird abgewiesen.
- Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
(Die Darstellung des Tatbestands orientiert sich an Ihrer Schilderung und fasst die wesentlichen Punkte zusammen. Hier werden keine Namen genannt, um die Vorlage flexibel zu halten.)
Der Kläger begehrt von der Beklagten die Rückzahlung des Kaufpreises für einen gebrauchten Tesla mit Luxusausstattung, Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs.
Der Kläger erwarb das Fahrzeug nach Besichtigung und Probefahrt im Autohaus der Beklagten. Innerhalb eines Jahres nach dem Kauf traten Ausfallerscheinungen auf, die den Kläger zur Aufforderung zur Reparatur veranlassten. Die Beklagte lehnte eine Reparatur ab. Der Kläger erklärte daraufhin den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte die Beklagte zur Rücknahme des Fahrzeugs und zur Rückzahlung des Kaufpreises, abzüglich einer Nutzungsentschädigung, auf. Die Beklagte reagierte nicht.
Der Kläger hat zunächst beantragt, die Beklagte zur Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs zu verurteilen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Duisburg hat der Kläger, unter Berücksichtigung weiterer gefahrener Strecken und einer entsprechenden Erhöhung des Nutzungsersatzes, die Klage für erledigt erklärt und einen entsprechenden geänderten Antrag angekündigt.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie beruft sich auf eine Herstellergarantie und darauf, dass der Kläger die ihm gewährte Umweltprämie in Höhe von 6.000 EUR bei der Rückabwicklung anrechnen lassen müsse. Sie hat der Erledigungserklärung des Klägers widersprochen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom [Datum der mündlichen Verhandlung] Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.
I. Zulässigkeit
Die Klage ist zulässig. Das Landgericht Duisburg ist gemäß § 29 ZPO zuständig, da sich der Erfüllungsort des Kaufvertrags, nämlich das Autohaus der Beklagten, im Bezirk des Landgerichts Duisburg befindet. Auch im Übrigen bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Klage.
II. Begründetheit
Die Klage ist jedoch unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs aus §§ 437 Nr. 2, 434, 440, 323, 346 BGB.
- Rücktrittsgrund: Es kann offenbleiben, ob ein Sachmangel im Sinne des § 434 BGB vorlag, der den Kläger zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt hätte. Selbst wenn ein solcher Mangel vorgelegen hätte, ist der Rücktritt des Klägers aufgrund der Einrede der Beklagten nach § 442 BGB ausgeschlossen.
a. Kenntnis des Mangels: Die Beklagte hat schlüssig dargelegt, dass der Kläger bei Kauf des Fahrzeugs Kenntnis von der Herstellergarantie hatte. Dies ergibt sich aus dem Vortrag der Beklagten, dass dem Kläger die Garantieunterlagen bei Vertragsschluss übergeben wurden. Zwar liegt der Kaufvertrag mit dem entsprechenden Passus nicht vor, jedoch trägt der Kläger die Beweislast für die Voraussetzungen des Rücktritts. Er hat jedoch die Behauptung der Beklagten nicht widerlegt.
b. Rechtsfolge: Kenntnis des Käufers von einem Mangel bei Vertragsschluss schließt gemäß § 442 BGB die Mängelrechte des Käufers aus. Dies gilt auch für den Rücktritt vom Kaufvertrag.
- Herstellergarantie: Selbst wenn man unterstellt, dass der Kläger nicht über die Garantie informiert wurde, ist die Klage unbegründet. Denn die Beklagte hat mit Erfolg die Einrede erhoben, dass der Kläger sich zunächst an den Hersteller zu wenden habe.
a. Subsidiarität: Die Herstellergarantie begründet einen direkten Anspruch des Klägers gegen den Hersteller. Es ist dem Kläger zuzumuten, diesen Anspruch zunächst geltend zu machen, bevor er die Beklagte als Verkäuferin in Anspruch nimmt. Dies entspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB).
b. Zumutbarkeit: Die Geltendmachung des Garantieanspruchs gegen den Hersteller ist dem Kläger zumutbar. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Hersteller zahlungsunfähig ist oder die Garantieansprüche unberechtigt ablehnt.
- Umweltprämie: Da die Klage bereits aus den vorgenannten Gründen abzuweisen ist, kommt es auf die Frage, ob der Kläger die Umweltprämie in Höhe von 6.000 EUR anrechnen lassen muss, nicht mehr entscheidungserheblich an.
- Erledigungserklärung: Da die Beklagte der Erledigungserklärung des Klägers widersprochen hat, war über den ursprünglichen Klageantrag zu entscheiden.
- Kosten: Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Da der Kläger unterlegen ist, hat er die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- Vorläufige Vollstreckbarkeit: Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung an das Oberlandesgericht [Name des Oberlandesgerichts] zulässig, wenn der Beschwerdewert 600,-€ übersteigt oder die Berufung durch das Landgericht zugelassen wurde. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Urteils beim Oberlandesgericht [Name des Oberlandesgerichts], [Adresse des Oberlandesgerichts], eingelegt und begründet werden.
Ergebnis: Gemini Flash 2.0 schreibt ein ausführlicheres Gutachten bzw. ausführlicheren Entscheidungsentwurf als ChatGPT, was sich mehr nach einer juristischen Lösung anhört. Der an sich nicht schwierige Fall wird aber von beiden KIs weitestgehend falsch gelöst.
Natürlich kann man nun einwenden, dass man den Prompt besser schreiben muss, damit dann die KI den Sachverhalt besser erfasst und so zur richtigen Lösung kommt. Dann brauche ich aber dann doch wieder einen Juristen, der das übernimmt. Als Betroffener ohne Rechtskenntnisse kann ich das nicht.
Stand jetzt lösen offenbar KI auch recht einfache Fälle wie den oben geschilderten Fall mal richtig und mal falsch. Daher also nicht verlässlich und somit faktisch unbrauchbar. Wir wollen aber natürlich nicht ausschließen, dass sich das noch in der Zukunft ändert.
14.02.2025, 15:29
(14.02.2025, 15:16)admin schrieb: Praxisbeispiel einer KI-Lösung zu einem Aktenvortrag, der kürzlich in NRW lief. Wir haben das mal probiert, weil CryptoKraut oben beschrieb, dass das KI-Ergebnis bei einer Probeexamensklausurs sehr gut ausfiel:Spannendes Experiment!
Sachverhalt
Es handelte sich um einen Aktenvortrag auf richterlicher Sicht. Klage erhoben hat eine Privatperson aus Duisburg gegen ein Autohaus mit Sitz in Dinslaken als GmbH. Der Kläger hat in seinem Schreiben angekündigt, zu beantragen, den Beklagten auf Rückzahlung des Kaufpreises für einen Tesla mit Luxusausstattung Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs zu verurteilen.
Der Kläger kaufte den Wagen nach Besichtigung und Probefahrt im Autohaus. Nach einigen Urlauben und Aufenthalten im Ausland und weniger als ein Jahr nach dem Kauf zeigte der Wagen Ausfallerscheinungen. So blieb er plötzlich stehen, die Lampen leuchteten auf und das Kfz war erst nach einiger Zeit wieder betriebsbereit. Daraufhin forderte der Kläger die Beklagte (also das Autohaus) auf, den Wagen zu reparieren, was diese verweigerte. Dann erklärte der Kläger mehrmals mit Schreiben den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte die Beklagte auf, den Wagen zurückzunehmen und den Kaufpreis – abzüglich eines Betrags für die gefahrenen Kilometer (Stichwort Nutzungen) – zurückzuzahlen, was diese jedoch verweigerte. Sie reagierte nicht auf die mehreren Schriftsätze des Klägers.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Sie wendete zum einen ein, der Kläger habe sich zunächst an den Hersteller zu wenden. Dieser habe eine sog. Herstellergarantie gegeben, die sie – die Beklagte – dem Kläger auch bei Vertragsschluss übergeben habe. Sie – die Beklagte – hafte grundsätzlich nicht für Schäden wegen der bestehenden Herstellergarantie. Es könne nicht sein, dass sie als Vertragspartnerin jetzt trotz der bestehenden Garantie in Anspruch genommen werde. Das würde den Sinn der Garantie vollkommen ad absurdum führen. Darüber hinaus habe der Kläger vom geforderten Kaufpreis eine Summe in Höhe von 6.000 EUR abzuziehen, denn er habe eine sog. Umweltprämie beantragt und auch erhalten. Diese solle aber den Verkäufern zugute kommen und letztlich den Käufern als Kaufanreiz dienen. Deshalb könne er – der Kläger – die beantragte Prämie nicht einfach einbehalten, sondern habe sie abzurechnen, also vom Kaufpreis im Rahmen der Rückabwicklung abzuziehen.
Abgedruckt – also in der Akte befindlich – war zwar nicht der Kaufvertrag mit dem Passus der Herstellergarantie, aber die Vorschriften des Amtes für Umwelt (… der genaue Name ist mir leider entfallen) über die Gewährung der Umweltprämie. Darin war unter anderem zu lesen, dass der „Käufer“ die Umweltprämie beantragen könne. Er habe das Fahrzeug dann sechs Monate zu nutzen, ansonsten müsse er (also der Käufer) die Prämie zurückzahlen.
Darüber hinaus war das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Duisburg abgedruckt. Darin hieß es, der klägerische Anwalt habe vorgetragen, sein Mandant sei mittlerweile weitere Strecken mit dem Auto gefahren, weshalb sich der Betrag für den Nutzungsersatz noch einmal erhöht habe. Dieser Betrag sei von dem sowieso schon heruntergesetzten Kaufpreis abzuziehen und insofern erkläre er die Klage für erledigt (entsprechend anders als in der Klageschrift lautete dann auch sein Antrag). Der Vertreter der Beklagten hingegen stimmte dem ausdrücklich nicht zu, sondern beantragte vielmehr (wie auch in seinem Schriftsatz), die Klage abzuweisen.
Die Aufgabe war es nun, die Entscheidung des Gerichts vorzuschlagen, wobei die Rechtsbehelfsbelehrung erlassen war. Das heißt, neben der Hauptentscheidung waren auch die Nebenentscheidungen (also die über die Kosten und die vorläufige Vollstreckbarkeit) darzustellen.
Lösung ChatGPT
Entscheidung des Gerichts:
1. Hauptentscheidung:
Die Klage wird abgewiesen.
Begründung:
Das Gericht stellt fest, dass der Kläger zunächst die Herstellergarantie des Herstellers in Anspruch nehmen muss, bevor er Ansprüche gegen das Autohaus geltend machen kann. Die Beklagte hat nachweislich die Herstellergarantie dem Kläger bei Vertragsschluss übergeben, und es ist nicht gerechtfertigt, dass die Beklagte für Mängel haftet, die unter diese Garantie fallen. Zudem hat der Kläger die Umweltprämie in Höhe von 6.000 EUR erhalten, die er im Rahmen der Rückabwicklung vom Kaufpreis abziehen muss. Der Kläger hat auch nicht nachgewiesen, dass er die Prämie zurückzahlen müsste, da er das Fahrzeug die erforderlichen sechs Monate genutzt hat.
2. Nebenentscheidungen:
a) Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger.
b) Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung wird angeordnet.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist bei dem zuständigen Oberlandesgericht einzureichen.
Lösung Gemini 2.0 Flash
- Die Klage wird abgewiesen.
- Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
(Die Darstellung des Tatbestands orientiert sich an Ihrer Schilderung und fasst die wesentlichen Punkte zusammen. Hier werden keine Namen genannt, um die Vorlage flexibel zu halten.)
Der Kläger begehrt von der Beklagten die Rückzahlung des Kaufpreises für einen gebrauchten Tesla mit Luxusausstattung, Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs.
Der Kläger erwarb das Fahrzeug nach Besichtigung und Probefahrt im Autohaus der Beklagten. Innerhalb eines Jahres nach dem Kauf traten Ausfallerscheinungen auf, die den Kläger zur Aufforderung zur Reparatur veranlassten. Die Beklagte lehnte eine Reparatur ab. Der Kläger erklärte daraufhin den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte die Beklagte zur Rücknahme des Fahrzeugs und zur Rückzahlung des Kaufpreises, abzüglich einer Nutzungsentschädigung, auf. Die Beklagte reagierte nicht.
Der Kläger hat zunächst beantragt, die Beklagte zur Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs zu verurteilen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Duisburg hat der Kläger, unter Berücksichtigung weiterer gefahrener Strecken und einer entsprechenden Erhöhung des Nutzungsersatzes, die Klage für erledigt erklärt und einen entsprechenden geänderten Antrag angekündigt.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie beruft sich auf eine Herstellergarantie und darauf, dass der Kläger die ihm gewährte Umweltprämie in Höhe von 6.000 EUR bei der Rückabwicklung anrechnen lassen müsse. Sie hat der Erledigungserklärung des Klägers widersprochen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom [Datum der mündlichen Verhandlung] Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.
I. Zulässigkeit
Die Klage ist zulässig. Das Landgericht Duisburg ist gemäß § 29 ZPO zuständig, da sich der Erfüllungsort des Kaufvertrags, nämlich das Autohaus der Beklagten, im Bezirk des Landgerichts Duisburg befindet. Auch im Übrigen bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Klage.
II. Begründetheit
Die Klage ist jedoch unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs aus §§ 437 Nr. 2, 434, 440, 323, 346 BGB.
III. Nebenentscheidungen
- Rücktrittsgrund: Es kann offenbleiben, ob ein Sachmangel im Sinne des § 434 BGB vorlag, der den Kläger zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt hätte. Selbst wenn ein solcher Mangel vorgelegen hätte, ist der Rücktritt des Klägers aufgrund der Einrede der Beklagten nach § 442 BGB ausgeschlossen.
a. Kenntnis des Mangels: Die Beklagte hat schlüssig dargelegt, dass der Kläger bei Kauf des Fahrzeugs Kenntnis von der Herstellergarantie hatte. Dies ergibt sich aus dem Vortrag der Beklagten, dass dem Kläger die Garantieunterlagen bei Vertragsschluss übergeben wurden. Zwar liegt der Kaufvertrag mit dem entsprechenden Passus nicht vor, jedoch trägt der Kläger die Beweislast für die Voraussetzungen des Rücktritts. Er hat jedoch die Behauptung der Beklagten nicht widerlegt.
b. Rechtsfolge: Kenntnis des Käufers von einem Mangel bei Vertragsschluss schließt gemäß § 442 BGB die Mängelrechte des Käufers aus. Dies gilt auch für den Rücktritt vom Kaufvertrag.
- Herstellergarantie: Selbst wenn man unterstellt, dass der Kläger nicht über die Garantie informiert wurde, ist die Klage unbegründet. Denn die Beklagte hat mit Erfolg die Einrede erhoben, dass der Kläger sich zunächst an den Hersteller zu wenden habe.
a. Subsidiarität: Die Herstellergarantie begründet einen direkten Anspruch des Klägers gegen den Hersteller. Es ist dem Kläger zuzumuten, diesen Anspruch zunächst geltend zu machen, bevor er die Beklagte als Verkäuferin in Anspruch nimmt. Dies entspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB).
b. Zumutbarkeit: Die Geltendmachung des Garantieanspruchs gegen den Hersteller ist dem Kläger zumutbar. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Hersteller zahlungsunfähig ist oder die Garantieansprüche unberechtigt ablehnt.
- Umweltprämie: Da die Klage bereits aus den vorgenannten Gründen abzuweisen ist, kommt es auf die Frage, ob der Kläger die Umweltprämie in Höhe von 6.000 EUR anrechnen lassen muss, nicht mehr entscheidungserheblich an.
- Erledigungserklärung: Da die Beklagte der Erledigungserklärung des Klägers widersprochen hat, war über den ursprünglichen Klageantrag zu entscheiden.
Rechtsbehelfsbelehrung
- Kosten: Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Da der Kläger unterlegen ist, hat er die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- Vorläufige Vollstreckbarkeit: Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung an das Oberlandesgericht [Name des Oberlandesgerichts] zulässig, wenn der Beschwerdewert 600,-€ übersteigt oder die Berufung durch das Landgericht zugelassen wurde. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Urteils beim Oberlandesgericht [Name des Oberlandesgerichts], [Adresse des Oberlandesgerichts], eingelegt und begründet werden.
Ergebnis: Gemini Flash 2.0 schreibt ein ausführlicheres Gutachten bzw. ausführlicheren Entscheidungsentwurf als ChatGPT, was sich mehr nach einer juristischen Lösung anhört. Der an sich nicht schwierige Fall wird aber von beiden KIs weitestgehend falsch gelöst.
Natürlich kann man nun einwenden, dass man den Prompt besser schreiben muss, damit dann die KI den Sachverhalt besser erfasst und so zur richtigen Lösung kommt. Dann brauche ich aber dann doch wieder einen Juristen, der das übernimmt. Als Betroffener ohne Rechtskenntnisse kann ich das nicht.
Stand jetzt lösen offenbar KI auch recht einfache Fälle wie den oben geschilderten Fall mal richtig und mal falsch. Daher also nicht verlässlich und somit faktisch unbrauchbar. Wir wollen aber natürlich nicht ausschließen, dass sich das noch in der Zukunft ändert.
Habe selber immer nur Fälle aus dem ersten Examen genommen, da hat man natürlich nen feststehenden Sachverhalt, den muss man sich im zweiten Examen selbst zusammenbauen. Ich denke, dass das auch noch ne nennenswerte Fehlerquelle sein kann
14.02.2025, 16:13
(14.02.2025, 15:29)CryptoKraut schrieb: Spannendes Experiment!
Habe selber immer nur Fälle aus dem ersten Examen genommen, da hat man natürlich nen feststehenden Sachverhalt, den muss man sich im zweiten Examen selbst zusammenbauen. Ich denke, dass das auch noch ne nennenswerte Fehlerquelle sein kann
Das ist ein guter Aspekt, dass KIs bei feststehenden Sachverhalten wahrscheinlich besser funktionieren. Man müsste mal zum Testen die Rechtsansichten der Beklagten entfernen und schauen, zu welchem Ergebnis dann die KIs kommen (und ob sie die entscheidenden Rechtsfragen, auf die man ja gerade durch die Rechtsansichten gestoßen wird, erkennt). In dem von uns geschilderten Fall geht das, weil der tatsächliche Sachverhalt unstreitig ist. Bei sehr vielen anderen Fällen aus dem 2. Examen wird das nicht funktionieren, da gerade der tatsächliche Sachverhalt zwischen den Parteien umstritten ist.