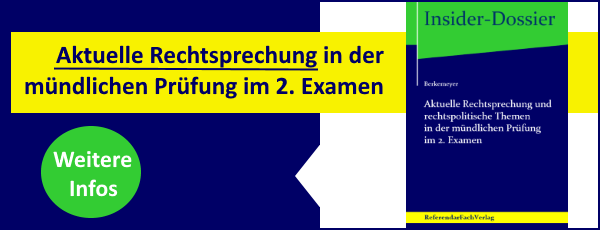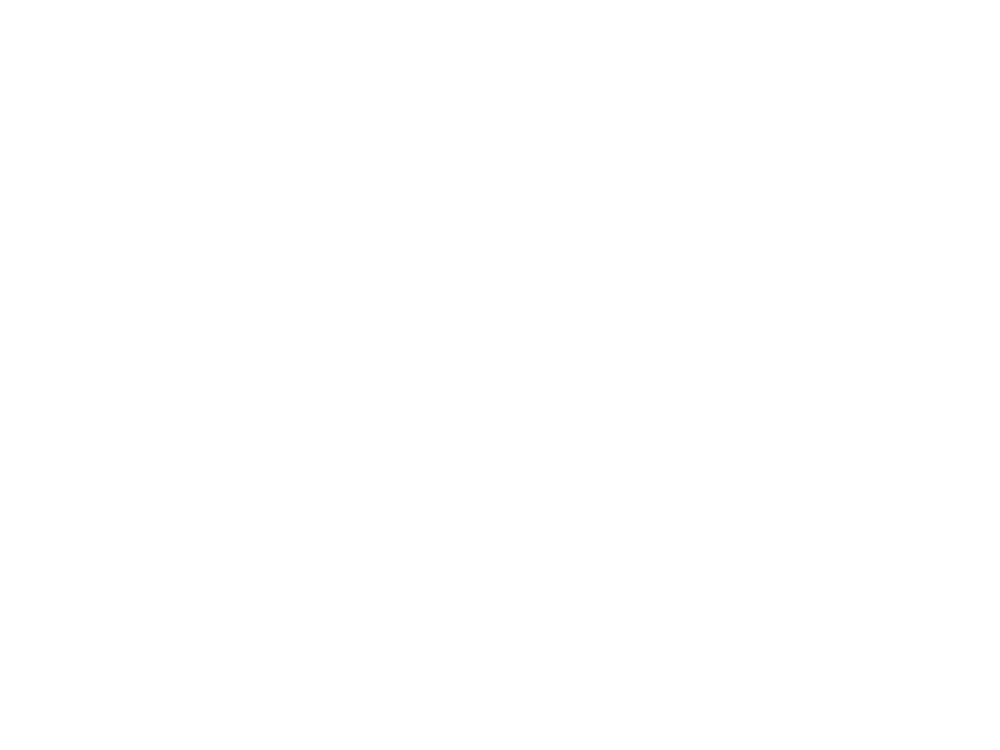24.04.2024, 16:00
Im September 2024 schreiben Referendare aus Hessen, NRW und dem GJPA-Bezirk (Berlin, Brandenburg) die Klausuren im 2. Staatsexamen.
Hessen:
02.09.: Z I
03.09.: Z III
05.09.: Z II
06.09.: AW
09.09.: S I
10.09.: S II
12.09.: Ö I
13.09.: Ö II
NRW:
02.09.: Z 1
03.09.: Z 2
05.09.: Z 3
06.09.: Z 4
09.09.: S 1
10.09.: S 2
12.09.: V 1
13.09.: V 2
GJPA-Bezirk (Berlin, Brandenburg):
02.09.: Z I
03.09.: Z II
05.09./06.09: Wahlklausur
09.09.: S I
10.09.: S II
12.09.: ÖR I
13.09.: ÖR II
Erläuterung der Bezeichnungen laut LJPA NRW:
Bei den "Z-Klausuren" handelt es sich um Aufgabenstellungen aus dem Zivilrecht. Im Regelfall sind die Aufgabenstellungen bei der Z-1 und der Z-3 Klausur aus gerichtlicher Sicht und bei der Z-2 und der Z-4 Klausur aus anwaltlicher Sicht zu bearbeiten.
Bei den "S-Klausuren" handelt es sich um Aufgabenstellungen aus dem Strafrecht. Im Regelfall ist bei der S-1 Klausur eine staatsanwaltschaftliche Abschlussverfügung zu fertigen; die Aufgabenstellung der S-2 Klausur ist offener, hier kommen zum Beispiel ein erstinstanzliches Urteil oder ein Gutachten zu Rechtsmitteln des Beschuldigten oder der Staatsanwaltschaft in Betracht.
Bei den "V-Klausuren" handelt es sich um Aufgabenstellungen aus dem öffentlichen Recht. Im Regelfall ist bei der V-1 Klausur die Aufgabe aus gerichtlicher Sicht zu bearbeiten, bei der V-2 Klausur kommen zum Beispiel eine behördliche Entscheidung oder eine anwaltliche Beratung in Betracht.
Wichtig: Damit man in der Diskussion zu den Klausuren verfolgen kann, auf welches Bundesland sich die Aussagen beziehen, wähle bitte beim Posten einen Namen und setze eine Abkürzung des Bundeslandes in Klammer, also zB Felix(NRW), Gast12(Hes), NoName(Berl).
Hessen:
02.09.: Z I
03.09.: Z III
05.09.: Z II
06.09.: AW
09.09.: S I
10.09.: S II
12.09.: Ö I
13.09.: Ö II
NRW:
02.09.: Z 1
03.09.: Z 2
05.09.: Z 3
06.09.: Z 4
09.09.: S 1
10.09.: S 2
12.09.: V 1
13.09.: V 2
GJPA-Bezirk (Berlin, Brandenburg):
02.09.: Z I
03.09.: Z II
05.09./06.09: Wahlklausur
09.09.: S I
10.09.: S II
12.09.: ÖR I
13.09.: ÖR II
Erläuterung der Bezeichnungen laut LJPA NRW:
Bei den "Z-Klausuren" handelt es sich um Aufgabenstellungen aus dem Zivilrecht. Im Regelfall sind die Aufgabenstellungen bei der Z-1 und der Z-3 Klausur aus gerichtlicher Sicht und bei der Z-2 und der Z-4 Klausur aus anwaltlicher Sicht zu bearbeiten.
Bei den "S-Klausuren" handelt es sich um Aufgabenstellungen aus dem Strafrecht. Im Regelfall ist bei der S-1 Klausur eine staatsanwaltschaftliche Abschlussverfügung zu fertigen; die Aufgabenstellung der S-2 Klausur ist offener, hier kommen zum Beispiel ein erstinstanzliches Urteil oder ein Gutachten zu Rechtsmitteln des Beschuldigten oder der Staatsanwaltschaft in Betracht.
Bei den "V-Klausuren" handelt es sich um Aufgabenstellungen aus dem öffentlichen Recht. Im Regelfall ist bei der V-1 Klausur die Aufgabe aus gerichtlicher Sicht zu bearbeiten, bei der V-2 Klausur kommen zum Beispiel eine behördliche Entscheidung oder eine anwaltliche Beratung in Betracht.
Wichtig: Damit man in der Diskussion zu den Klausuren verfolgen kann, auf welches Bundesland sich die Aussagen beziehen, wähle bitte beim Posten einen Namen und setze eine Abkürzung des Bundeslandes in Klammer, also zB Felix(NRW), Gast12(Hes), NoName(Berl).
28.08.2024, 20:15
Hey hey, ziemlich ruhig hier!
Bald gehts los... wie sieht es bei euch mit der Aufregung aus und habt ihr heiße Tipps ?:)
Bald gehts los... wie sieht es bei euch mit der Aufregung aus und habt ihr heiße Tipps ?:)
03.09.2024, 08:06
Wie liefs bei euch so in Z1 und Z2? :)
03.09.2024, 09:01
Könnte jemand bitte kleine Zusammenfassungen von den Klausuren reinstellen? Viel Erfolg euch!!!
03.09.2024, 22:13
Z1 Sachverhalt
K klagt gegen B1 und B2 (Haftpflichtversicherung AG des B1) als Gesamtschuldner auf Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall. K ist Halter eines Campers, den er gelegentlich seiner Freundin F überlässt, wobei diese morgens den Schlüssel bekommt und abends wieder zurückgibt. So auch am Unfalltag. F kollidiert im Camper auf einer Kreuzung mit dem von rechts kommenden BMW des B1, der auch Halter und Eigentümer des BMW ist. Die Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt temporär (baustellenbedingt) mit einer Lichtzeichenanlage geregelt, wobei jedenfalls die Ampel bei B1 über keine Abschirmblende (aka Sonnenschutz) verfügte. Hinter dem B1 fuhr der Zeuge W. Fest steht: Entweder ist B1 über Rot gefahren oder die F. Beide werfen sich gegenseitig einen Rotlichtverstoß (§ 37 StVO) vor und behaupten, selbst über Grün gefahren zu sein. Wegen der tief stehenden Sonne hinter ihm und der fehlenden Abschirmblende konnte B1 das Ampellicht beim Heranfahren nicht gut erkennen (wohl § 7 Abs. 2, 17 Abs. 3 StVG anzusprechen).
Der K begehrt schon vorgerichtlich gegenüber B1 und B2 den Ersatz folgende Schadensposten:
- tatsächlich bezahlte Reparaturkosten, die zwischen dem Wiederbeschaffungsaufwand und dem Wiederbeschaffungswert liegen
- Gutachterkosten
- Nutzungsausfall für die Zeit der Reparatur
Bezüglich letzterem ist unstreitig, dass der K über einen Ersatzwagen verfügt. Er macht geltend, dass er während der Reparaturzeit eigentlich vorhatte, mit dem Camper eine Norwegenreise zu machen (konkrete Stornokosten trägt er nicht vor - daher nicht ersatzfähig, weil Freizeitplanung grds. allgemeines Lebensrisiko).
B2 bezahlt vorgerichtlich und im Rahmen der gesetzten Zahlungsfrist die Hälfte der ersten beiden Schadensposten (Erfüllungswirkung auch für B1 gem. §§ 115 Abs. 1 S. 4 VVG, 422, 362 BGB) und verweigert die Zahlung im Übrigen. Die Klage umfasst die zweite Hälfte der ersten beiden Schadensposten und den vollen Schadensersatz wegen Nutzungsausfall. Außerdem Jahreszinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem Tag nach Ende der Zahlungsfrist (Verzugszinsen).
Die Beklagtenseite bestreitet die Aktivlegitimation des K. Dieser trägt substantiiert und unter Vorlage des Kaufvertrags zum Kauf des Campers vor und beruft sich im Übrigen auf die gesetzliche Eigentumsvermutung (§ 1006 Abs. 3 BGB).
B1 erhebt (Dritt-)Widerklage gegen K, F und eine Versicherungs AG als Gesamtschuldner, wobei er (wenn ich das trotz mehrfacher Kontrolle nicht übersehen habe) gar nicht vorträgt, um wessen Versicherung es sich handelt. Er verlangt folgende Schadensposten:
- fiktive Reparaturkosten, wobei diese unter dem Wiederbeschaffungsaufwand liegen
- Gutachterkosten
- Aufwandsentschädigung i. H. v. 20 Euro
Er beantragt außerdem Prozesszinsen nach Rechtshängigkeit, allerdings nur in Höhe von 5 Prozentpunkten (wegen § 308 ZPO und Unzweideutigkeit wohl keiner Auslegung zugänglich?).
Die Entscheidung wird auf einen Einzelrichter übertragen und erfolgt nach Beschluss im schriftlichen Verfahren (beide Seiten hatten dem zugestimmt, daher gem. § 128 Abs. 2 ZPO zulässig). Zuvor wird in öffentlicher Sitzung Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen W und zweier Polizeibeamter Y und H, die nach dem Unfall zur Unfallstelle gekommen waren. Y hatte mit den Beteiligten und dem Zeugen W gesprochen. W trägt vor, dass er selbst kurz hinter B1 über Grün gefahren sei, aber nicht darauf geachtet habe, ob die Ampel für B1 beim Passieren dieser auch schon Grün zeigte. Y vermutet einen Rotlichtverstoß seitens B1, erklärt aber gleichzeitig, dass ihm gegenüber nach dem Unfall niemand einen Rotlichtverstoß zugegeben habe. H hatte gar nicht mit den Beteiligten gesprochen. Alle Zeugen bestätigen die tief stehende Sonne und die deswegen schlechten Sichtverhältnisse. W bezeugt, dass B1 kurz vor der Ampel abbremste.
Die Versicherungen haben beide ihren Sitz außerhalb der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (was aber wegen §§ 20 StVG, 32, 35 ZPO unerheblich war).
Der Klägervertreter rügt die Zulässigkeit der Drittwiderklage (folglich wohl zu prüfen: allgemeine Zulässigkeitserwägungen, § 59 ZPO und 263 ZPO analog).
Ein Schwerpunkt war sicher die Beweiswürdigung im Rahmen des § 17 StVG. Die in Klammern gesetzten Normen sind Vermutungen meinerseits - muss also nicht stimmen. Ich empfand die Klausur als sehr zeitintensiv, wenn auch mit grundlegenden Kenntnissen zur StVG und den gängigen Schadenspositionen bei Verkehrsunfällen gut bewältigbar.
K klagt gegen B1 und B2 (Haftpflichtversicherung AG des B1) als Gesamtschuldner auf Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall. K ist Halter eines Campers, den er gelegentlich seiner Freundin F überlässt, wobei diese morgens den Schlüssel bekommt und abends wieder zurückgibt. So auch am Unfalltag. F kollidiert im Camper auf einer Kreuzung mit dem von rechts kommenden BMW des B1, der auch Halter und Eigentümer des BMW ist. Die Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt temporär (baustellenbedingt) mit einer Lichtzeichenanlage geregelt, wobei jedenfalls die Ampel bei B1 über keine Abschirmblende (aka Sonnenschutz) verfügte. Hinter dem B1 fuhr der Zeuge W. Fest steht: Entweder ist B1 über Rot gefahren oder die F. Beide werfen sich gegenseitig einen Rotlichtverstoß (§ 37 StVO) vor und behaupten, selbst über Grün gefahren zu sein. Wegen der tief stehenden Sonne hinter ihm und der fehlenden Abschirmblende konnte B1 das Ampellicht beim Heranfahren nicht gut erkennen (wohl § 7 Abs. 2, 17 Abs. 3 StVG anzusprechen).
Der K begehrt schon vorgerichtlich gegenüber B1 und B2 den Ersatz folgende Schadensposten:
- tatsächlich bezahlte Reparaturkosten, die zwischen dem Wiederbeschaffungsaufwand und dem Wiederbeschaffungswert liegen
- Gutachterkosten
- Nutzungsausfall für die Zeit der Reparatur
Bezüglich letzterem ist unstreitig, dass der K über einen Ersatzwagen verfügt. Er macht geltend, dass er während der Reparaturzeit eigentlich vorhatte, mit dem Camper eine Norwegenreise zu machen (konkrete Stornokosten trägt er nicht vor - daher nicht ersatzfähig, weil Freizeitplanung grds. allgemeines Lebensrisiko).
B2 bezahlt vorgerichtlich und im Rahmen der gesetzten Zahlungsfrist die Hälfte der ersten beiden Schadensposten (Erfüllungswirkung auch für B1 gem. §§ 115 Abs. 1 S. 4 VVG, 422, 362 BGB) und verweigert die Zahlung im Übrigen. Die Klage umfasst die zweite Hälfte der ersten beiden Schadensposten und den vollen Schadensersatz wegen Nutzungsausfall. Außerdem Jahreszinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem Tag nach Ende der Zahlungsfrist (Verzugszinsen).
Die Beklagtenseite bestreitet die Aktivlegitimation des K. Dieser trägt substantiiert und unter Vorlage des Kaufvertrags zum Kauf des Campers vor und beruft sich im Übrigen auf die gesetzliche Eigentumsvermutung (§ 1006 Abs. 3 BGB).
B1 erhebt (Dritt-)Widerklage gegen K, F und eine Versicherungs AG als Gesamtschuldner, wobei er (wenn ich das trotz mehrfacher Kontrolle nicht übersehen habe) gar nicht vorträgt, um wessen Versicherung es sich handelt. Er verlangt folgende Schadensposten:
- fiktive Reparaturkosten, wobei diese unter dem Wiederbeschaffungsaufwand liegen
- Gutachterkosten
- Aufwandsentschädigung i. H. v. 20 Euro
Er beantragt außerdem Prozesszinsen nach Rechtshängigkeit, allerdings nur in Höhe von 5 Prozentpunkten (wegen § 308 ZPO und Unzweideutigkeit wohl keiner Auslegung zugänglich?).
Die Entscheidung wird auf einen Einzelrichter übertragen und erfolgt nach Beschluss im schriftlichen Verfahren (beide Seiten hatten dem zugestimmt, daher gem. § 128 Abs. 2 ZPO zulässig). Zuvor wird in öffentlicher Sitzung Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen W und zweier Polizeibeamter Y und H, die nach dem Unfall zur Unfallstelle gekommen waren. Y hatte mit den Beteiligten und dem Zeugen W gesprochen. W trägt vor, dass er selbst kurz hinter B1 über Grün gefahren sei, aber nicht darauf geachtet habe, ob die Ampel für B1 beim Passieren dieser auch schon Grün zeigte. Y vermutet einen Rotlichtverstoß seitens B1, erklärt aber gleichzeitig, dass ihm gegenüber nach dem Unfall niemand einen Rotlichtverstoß zugegeben habe. H hatte gar nicht mit den Beteiligten gesprochen. Alle Zeugen bestätigen die tief stehende Sonne und die deswegen schlechten Sichtverhältnisse. W bezeugt, dass B1 kurz vor der Ampel abbremste.
Die Versicherungen haben beide ihren Sitz außerhalb der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (was aber wegen §§ 20 StVG, 32, 35 ZPO unerheblich war).
Der Klägervertreter rügt die Zulässigkeit der Drittwiderklage (folglich wohl zu prüfen: allgemeine Zulässigkeitserwägungen, § 59 ZPO und 263 ZPO analog).
Ein Schwerpunkt war sicher die Beweiswürdigung im Rahmen des § 17 StVG. Die in Klammern gesetzten Normen sind Vermutungen meinerseits - muss also nicht stimmen. Ich empfand die Klausur als sehr zeitintensiv, wenn auch mit grundlegenden Kenntnissen zur StVG und den gängigen Schadenspositionen bei Verkehrsunfällen gut bewältigbar.
03.09.2024, 23:13
Sachverhalt Z2 in Berlin
Es handelt sich um eine Anwaltsklausur aus Beklagtensicht. Gegen den Mandanten ist bereits ein Versäumnisurteil ergangen (jedenfalls entspricht die Rechtsbehelfsbelehrung der eines VU), welches allerdings (entgegen § 313b Abs. 1 S. 2 ZPO) lediglich als "Urteil" bezeichnet ist.
Der Mandant will gegen das VU vorgehen, aber keine Instanz überspringen (Hinweis auf den Meistbegünstigungsgrundsatz). Gegenansprüche will er nur geltend machen, wenn er selbst zahlen muss, aber keine Klage oder Widerklage erheben. Er hat nur wenig Geld und muss noch sein Haus abbezahlen (-> PKH-Antrag). Der Mandant will außerdem wissen, welche Kosten ihm bei vollständigem Unterliegen blühen und welche Kosten auf ihn bei einem Vergleich über 2000 Euro mit entsprechender Kostenquotelung zukommen. Auszurechnen waren die Kosten nicht.
Der Beklagte ist Sammler und Liebhaber hochwertiger Uhren und repariert auch regelmäßig solche für Bekannte und Freunde, ohne von ihnen eine Vergütung zu verlangen. Beruflich ist er gelernter Zimmermann und als Aushilfe in einer Tischlerei tätig. Das Uhrenhandwerk hat er sich selbst beigebracht. Er betreibt eine Website, auf der er den Wert von Markenuhren schätzt, die teilweise ihm gehören und ihm teilweise auch fremd sind. Darauf weist er auf der Website auch hin. Außerdem steht auf der Startseite der Website einleitend, dass er Uhrensammler ist und Austausch mit Gleichgesinnten, insbesondere zum Thema Reparatur, sucht. Die Website beinhaltet auch AGB, wonach er für Beschädigungen und Verlust nicht haftet.
Die Klägerin ist Eigentümerin einer Uhr, die ein Erbstück ihres Vaters ist. Sie selbst kennt den Beklagten nicht. Der Kontakt zwischen den Parteien wird durch T vermittelt, der den Beklagten gut kennt und zwar keine Ahnung von Uhren hat, aber umfassende Kenntnis vom Hobby des Beklagten. Die Klägerin bittet T, ihre Uhr beim Beklagten in Reparatur zu geben und vertraut ihm im Übrigen den Vertragsschluss an; T bittet im Namen der Klägerin beim Beklagten darum, nach Möglichkeit die erforderlichen Ersatzteile zu besorgen und die Uhr zu reparieren. Eine Vergütung wird nicht vereinbart. Ein Hinweis auf die AGB erfolgt auch nicht.
Die Besorgung der Ersatzteile und die Reparatur soll einige Zeit in Anspruch nehmen, was der Beklagte den T auch bei der Übergabe der Uhr wissen lässt. Im Folgenden lagert die Uhr offen auf der Werkbank des Beklagten. Als dieser für zwei Wochen in Urlaub fährt, ohne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, wird die Uhr von unbekannten Dritten neben anderen Sachen des Beklagten aus dessen Wohnung gestohlen. Eine Versicherung hat der Beklagte nicht. Auf seiner Website ist nur ein Postfach angegeben, nicht seine Adresse.
Die Klägerin hat nun nach vorheriger erfolgloser Zahlungsaufforderung den Beklagten verklagt, an sie 9700 Euro als Schadensersatz zu zahlen. Die Schadenshöhe entspricht einer Schätzung eines auf Uhren spezialisierten Auktionshauses im Auftrag der Klägerin auf Grundlage eines Fotos von der Uhr. Mangels rechtzeitiger Verteidigungsanzeige im schriftlichen Vorverfahren wird der Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Einspruchsfrist läuft noch.
Aus der Klagebegründung ergibt sich, dass die Klägerin davon ausging, dass es sich beim Beklagten um einen gewerblich handelnden Uhrenspezialisten handelt. Sie verweist diesbezüglich auf die Website, wobei schon aus dem Vermerk des Anwalts hervorgeht, dass dieser Eindruck durch die Website gerade nicht vermittelt wird. Die Klägerin ging beim Vertragsschluss auch davon aus, den Beklagten nach der Reparatur zu vergüten. Sie ist der Ansicht, dass der Beklagte eine Treuepflicht in Form einer Schutz-/Aufklärungspflicht verletzt hat, weil er die Uhr weder gesichert lagerte, noch über eine Versicherung verfügte, noch die Klägerin hierüber aufklärte. Für einen Juwelier sei anerkannt, dass er entsprechende Pflichten habe - dann müsse das für den Beklagten auch gelten.
Der Beklagte ging beim Vertragsschluss ebenfalls davon aus, vergütet zu werden. Er fragt aber, ob es für ihn ggf. günstiger wäre, diesen Vortrag zurückzuhalten. Die beantragte Schadenshöhe irritiert ihn: Ein Sammlerfreund von ihm hatte den Wert der gestohlenen Uhr auf 2000 Euro geschätzt.
Vor dem Diebstahl hat der Beklagte noch für die Reparatur erforderliche Kleinteile bei einem Sammlerkollegen im Wert von 200 Euro gekauft, die er noch nicht eingebaut hatte. Diese waren bei offiziellen Händlern nicht zu erwerben gewesen.
Ohne Gewähr: Es gibt vermutlich mehrere richtige Lösungsansätze, wobei die Abgrenzung von Gefälligkeitsverhältnis und Rechtsbindungswillen sicher einen Schwerpunkt darstellte. Die Zurechnung des Vertreterwissens nach § 166 BGB war m. E. streitentscheidend. Bei Annahme von Unentgeltlichkeit war wohl § 690 BGB anzusprechen. Möglicherweise spielten die Hinweise der Klägerin auf § 472 HGB an. Neben dem Hauptsache- und dem PKH-Antrag war ein Antrag nach §§ 707, 719 ZPO zweckmäßig. Die hilfsweise Aufrechnung war im Schriftsatz zu erklären. Bei der Kostenfrage waren dann § 45 Abs. 3 GKG und § 344 ZPO anzusprechen und die Anlagen zum GKG/RVG.
Es handelt sich um eine Anwaltsklausur aus Beklagtensicht. Gegen den Mandanten ist bereits ein Versäumnisurteil ergangen (jedenfalls entspricht die Rechtsbehelfsbelehrung der eines VU), welches allerdings (entgegen § 313b Abs. 1 S. 2 ZPO) lediglich als "Urteil" bezeichnet ist.
Der Mandant will gegen das VU vorgehen, aber keine Instanz überspringen (Hinweis auf den Meistbegünstigungsgrundsatz). Gegenansprüche will er nur geltend machen, wenn er selbst zahlen muss, aber keine Klage oder Widerklage erheben. Er hat nur wenig Geld und muss noch sein Haus abbezahlen (-> PKH-Antrag). Der Mandant will außerdem wissen, welche Kosten ihm bei vollständigem Unterliegen blühen und welche Kosten auf ihn bei einem Vergleich über 2000 Euro mit entsprechender Kostenquotelung zukommen. Auszurechnen waren die Kosten nicht.
Der Beklagte ist Sammler und Liebhaber hochwertiger Uhren und repariert auch regelmäßig solche für Bekannte und Freunde, ohne von ihnen eine Vergütung zu verlangen. Beruflich ist er gelernter Zimmermann und als Aushilfe in einer Tischlerei tätig. Das Uhrenhandwerk hat er sich selbst beigebracht. Er betreibt eine Website, auf der er den Wert von Markenuhren schätzt, die teilweise ihm gehören und ihm teilweise auch fremd sind. Darauf weist er auf der Website auch hin. Außerdem steht auf der Startseite der Website einleitend, dass er Uhrensammler ist und Austausch mit Gleichgesinnten, insbesondere zum Thema Reparatur, sucht. Die Website beinhaltet auch AGB, wonach er für Beschädigungen und Verlust nicht haftet.
Die Klägerin ist Eigentümerin einer Uhr, die ein Erbstück ihres Vaters ist. Sie selbst kennt den Beklagten nicht. Der Kontakt zwischen den Parteien wird durch T vermittelt, der den Beklagten gut kennt und zwar keine Ahnung von Uhren hat, aber umfassende Kenntnis vom Hobby des Beklagten. Die Klägerin bittet T, ihre Uhr beim Beklagten in Reparatur zu geben und vertraut ihm im Übrigen den Vertragsschluss an; T bittet im Namen der Klägerin beim Beklagten darum, nach Möglichkeit die erforderlichen Ersatzteile zu besorgen und die Uhr zu reparieren. Eine Vergütung wird nicht vereinbart. Ein Hinweis auf die AGB erfolgt auch nicht.
Die Besorgung der Ersatzteile und die Reparatur soll einige Zeit in Anspruch nehmen, was der Beklagte den T auch bei der Übergabe der Uhr wissen lässt. Im Folgenden lagert die Uhr offen auf der Werkbank des Beklagten. Als dieser für zwei Wochen in Urlaub fährt, ohne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, wird die Uhr von unbekannten Dritten neben anderen Sachen des Beklagten aus dessen Wohnung gestohlen. Eine Versicherung hat der Beklagte nicht. Auf seiner Website ist nur ein Postfach angegeben, nicht seine Adresse.
Die Klägerin hat nun nach vorheriger erfolgloser Zahlungsaufforderung den Beklagten verklagt, an sie 9700 Euro als Schadensersatz zu zahlen. Die Schadenshöhe entspricht einer Schätzung eines auf Uhren spezialisierten Auktionshauses im Auftrag der Klägerin auf Grundlage eines Fotos von der Uhr. Mangels rechtzeitiger Verteidigungsanzeige im schriftlichen Vorverfahren wird der Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Einspruchsfrist läuft noch.
Aus der Klagebegründung ergibt sich, dass die Klägerin davon ausging, dass es sich beim Beklagten um einen gewerblich handelnden Uhrenspezialisten handelt. Sie verweist diesbezüglich auf die Website, wobei schon aus dem Vermerk des Anwalts hervorgeht, dass dieser Eindruck durch die Website gerade nicht vermittelt wird. Die Klägerin ging beim Vertragsschluss auch davon aus, den Beklagten nach der Reparatur zu vergüten. Sie ist der Ansicht, dass der Beklagte eine Treuepflicht in Form einer Schutz-/Aufklärungspflicht verletzt hat, weil er die Uhr weder gesichert lagerte, noch über eine Versicherung verfügte, noch die Klägerin hierüber aufklärte. Für einen Juwelier sei anerkannt, dass er entsprechende Pflichten habe - dann müsse das für den Beklagten auch gelten.
Der Beklagte ging beim Vertragsschluss ebenfalls davon aus, vergütet zu werden. Er fragt aber, ob es für ihn ggf. günstiger wäre, diesen Vortrag zurückzuhalten. Die beantragte Schadenshöhe irritiert ihn: Ein Sammlerfreund von ihm hatte den Wert der gestohlenen Uhr auf 2000 Euro geschätzt.
Vor dem Diebstahl hat der Beklagte noch für die Reparatur erforderliche Kleinteile bei einem Sammlerkollegen im Wert von 200 Euro gekauft, die er noch nicht eingebaut hatte. Diese waren bei offiziellen Händlern nicht zu erwerben gewesen.
Ohne Gewähr: Es gibt vermutlich mehrere richtige Lösungsansätze, wobei die Abgrenzung von Gefälligkeitsverhältnis und Rechtsbindungswillen sicher einen Schwerpunkt darstellte. Die Zurechnung des Vertreterwissens nach § 166 BGB war m. E. streitentscheidend. Bei Annahme von Unentgeltlichkeit war wohl § 690 BGB anzusprechen. Möglicherweise spielten die Hinweise der Klägerin auf § 472 HGB an. Neben dem Hauptsache- und dem PKH-Antrag war ein Antrag nach §§ 707, 719 ZPO zweckmäßig. Die hilfsweise Aufrechnung war im Schriftsatz zu erklären. Bei der Kostenfrage waren dann § 45 Abs. 3 GKG und § 344 ZPO anzusprechen und die Anlagen zum GKG/RVG.
04.09.2024, 00:19
(03.09.2024, 23:13)Gast(Berlin) schrieb: Sachverhalt Z2 in Berlin
Es handelt sich um eine Anwaltsklausur aus Beklagtensicht. Gegen den Mandanten ist bereits ein Versäumnisurteil ergangen (jedenfalls entspricht die Rechtsbehelfsbelehrung der eines VU), welches allerdings (entgegen § 313b Abs. 1 S. 2 ZPO) lediglich als "Urteil" bezeichnet ist.
Der Mandant will gegen das VU vorgehen, aber keine Instanz überspringen (Hinweis auf den Meistbegünstigungsgrundsatz). Gegenansprüche will er nur geltend machen, wenn er selbst zahlen muss, aber keine Klage oder Widerklage erheben. Er hat nur wenig Geld und muss noch sein Haus abbezahlen (-> PKH-Antrag). Der Mandant will außerdem wissen, welche Kosten ihm bei vollständigem Unterliegen blühen und welche Kosten auf ihn bei einem Vergleich über 2000 Euro mit entsprechender Kostenquotelung zukommen. Auszurechnen waren die Kosten nicht.
Der Beklagte ist Sammler und Liebhaber hochwertiger Uhren und repariert auch regelmäßig solche für Bekannte und Freunde, ohne von ihnen eine Vergütung zu verlangen. Beruflich ist er gelernter Zimmermann und als Aushilfe in einer Tischlerei tätig. Das Uhrenhandwerk hat er sich selbst beigebracht. Er betreibt eine Website, auf der er den Wert von Markenuhren schätzt, die teilweise ihm gehören und ihm teilweise auch fremd sind. Darauf weist er auf der Website auch hin. Außerdem steht auf der Startseite der Website einleitend, dass er Uhrensammler ist und Austausch mit Gleichgesinnten, insbesondere zum Thema Reparatur, sucht. Die Website beinhaltet auch AGB, wonach er für Beschädigungen und Verlust nicht haftet.
Die Klägerin ist Eigentümerin einer Uhr, die ein Erbstück ihres Vaters ist. Sie selbst kennt den Beklagten nicht. Der Kontakt zwischen den Parteien wird durch T vermittelt, der den Beklagten gut kennt und zwar keine Ahnung von Uhren hat, aber umfassende Kenntnis vom Hobby des Beklagten. Die Klägerin bittet T, ihre Uhr beim Beklagten in Reparatur zu geben und vertraut ihm im Übrigen den Vertragsschluss an; T bittet im Namen der Klägerin beim Beklagten darum, nach Möglichkeit die erforderlichen Ersatzteile zu besorgen und die Uhr zu reparieren. Eine Vergütung wird nicht vereinbart. Ein Hinweis auf die AGB erfolgt auch nicht.
Die Besorgung der Ersatzteile und die Reparatur soll einige Zeit in Anspruch nehmen, was der Beklagte den T auch bei der Übergabe der Uhr wissen lässt. Im Folgenden lagert die Uhr offen auf der Werkbank des Beklagten. Als dieser für zwei Wochen in Urlaub fährt, ohne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, wird die Uhr von unbekannten Dritten neben anderen Sachen des Beklagten aus dessen Wohnung gestohlen. Eine Versicherung hat der Beklagte nicht. Auf seiner Website ist nur ein Postfach angegeben, nicht seine Adresse.
Die Klägerin hat nun nach vorheriger erfolgloser Zahlungsaufforderung den Beklagten verklagt, an sie 9700 Euro als Schadensersatz zu zahlen. Die Schadenshöhe entspricht einer Schätzung eines auf Uhren spezialisierten Auktionshauses im Auftrag der Klägerin auf Grundlage eines Fotos von der Uhr. Mangels rechtzeitiger Verteidigungsanzeige im schriftlichen Vorverfahren wird der Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Einspruchsfrist läuft noch.
Aus der Klagebegründung ergibt sich, dass die Klägerin davon ausging, dass es sich beim Beklagten um einen gewerblich handelnden Uhrenspezialisten handelt. Sie verweist diesbezüglich auf die Website, wobei schon aus dem Vermerk des Anwalts hervorgeht, dass dieser Eindruck durch die Website gerade nicht vermittelt wird. Die Klägerin ging beim Vertragsschluss auch davon aus, den Beklagten nach der Reparatur zu vergüten. Sie ist der Ansicht, dass der Beklagte eine Treuepflicht in Form einer Schutz-/Aufklärungspflicht verletzt hat, weil er die Uhr weder gesichert lagerte, noch über eine Versicherung verfügte, noch die Klägerin hierüber aufklärte. Für einen Juwelier sei anerkannt, dass er entsprechende Pflichten habe - dann müsse das für den Beklagten auch gelten.
Der Beklagte ging beim Vertragsschluss ebenfalls davon aus, vergütet zu werden. Er fragt aber, ob es für ihn ggf. günstiger wäre, diesen Vortrag zurückzuhalten. Die beantragte Schadenshöhe irritiert ihn: Ein Sammlerfreund von ihm hatte den Wert der gestohlenen Uhr auf 2000 Euro geschätzt.
Vor dem Diebstahl hat der Beklagte noch für die Reparatur erforderliche Kleinteile bei einem Sammlerkollegen im Wert von 200 Euro gekauft, die er noch nicht eingebaut hatte. Diese waren bei offiziellen Händlern nicht zu erwerben gewesen.
Ohne Gewähr: Es gibt vermutlich mehrere richtige Lösungsansätze, wobei die Abgrenzung von Gefälligkeitsverhältnis und Rechtsbindungswillen sicher einen Schwerpunkt darstellte. Die Zurechnung des Vertreterwissens nach § 166 BGB war m. E. streitentscheidend. Bei Annahme von Unentgeltlichkeit war wohl § 690 BGB anzusprechen. Möglicherweise spielten die Hinweise der Klägerin auf § 472 HGB an. Neben dem Hauptsache- und dem PKH-Antrag war ein Antrag nach §§ 707, 719 ZPO zweckmäßig. Die hilfsweise Aufrechnung war im Schriftsatz zu erklären. Bei der Kostenfrage waren dann § 45 Abs. 3 GKG und § 344 ZPO anzusprechen und die Anlagen zum GKG/RVG.
Wow! Sehr ausführlich! Danke. Kann jemand bestätigen ob das auch so in Hessen lief? Im Mündlichen werden ab und an auch mal die aktuelle schriftlichen Examensthemen herangezogen… ich hoffe der nächste Durchgang macht das auch wieder so für euch! Lg
04.09.2024, 11:19
(04.09.2024, 00:19)Dan(Hess) schrieb:(03.09.2024, 23:13)Gast(Berlin) schrieb: Sachverhalt Z2 in Berlin
Es handelt sich um eine Anwaltsklausur aus Beklagtensicht. Gegen den Mandanten ist bereits ein Versäumnisurteil ergangen (jedenfalls entspricht die Rechtsbehelfsbelehrung der eines VU), welches allerdings (entgegen § 313b Abs. 1 S. 2 ZPO) lediglich als "Urteil" bezeichnet ist.
Der Mandant will gegen das VU vorgehen, aber keine Instanz überspringen (Hinweis auf den Meistbegünstigungsgrundsatz). Gegenansprüche will er nur geltend machen, wenn er selbst zahlen muss, aber keine Klage oder Widerklage erheben. Er hat nur wenig Geld und muss noch sein Haus abbezahlen (-> PKH-Antrag). Der Mandant will außerdem wissen, welche Kosten ihm bei vollständigem Unterliegen blühen und welche Kosten auf ihn bei einem Vergleich über 2000 Euro mit entsprechender Kostenquotelung zukommen. Auszurechnen waren die Kosten nicht.
Der Beklagte ist Sammler und Liebhaber hochwertiger Uhren und repariert auch regelmäßig solche für Bekannte und Freunde, ohne von ihnen eine Vergütung zu verlangen. Beruflich ist er gelernter Zimmermann und als Aushilfe in einer Tischlerei tätig. Das Uhrenhandwerk hat er sich selbst beigebracht. Er betreibt eine Website, auf der er den Wert von Markenuhren schätzt, die teilweise ihm gehören und ihm teilweise auch fremd sind. Darauf weist er auf der Website auch hin. Außerdem steht auf der Startseite der Website einleitend, dass er Uhrensammler ist und Austausch mit Gleichgesinnten, insbesondere zum Thema Reparatur, sucht. Die Website beinhaltet auch AGB, wonach er für Beschädigungen und Verlust nicht haftet.
Die Klägerin ist Eigentümerin einer Uhr, die ein Erbstück ihres Vaters ist. Sie selbst kennt den Beklagten nicht. Der Kontakt zwischen den Parteien wird durch T vermittelt, der den Beklagten gut kennt und zwar keine Ahnung von Uhren hat, aber umfassende Kenntnis vom Hobby des Beklagten. Die Klägerin bittet T, ihre Uhr beim Beklagten in Reparatur zu geben und vertraut ihm im Übrigen den Vertragsschluss an; T bittet im Namen der Klägerin beim Beklagten darum, nach Möglichkeit die erforderlichen Ersatzteile zu besorgen und die Uhr zu reparieren. Eine Vergütung wird nicht vereinbart. Ein Hinweis auf die AGB erfolgt auch nicht.
Die Besorgung der Ersatzteile und die Reparatur soll einige Zeit in Anspruch nehmen, was der Beklagte den T auch bei der Übergabe der Uhr wissen lässt. Im Folgenden lagert die Uhr offen auf der Werkbank des Beklagten. Als dieser für zwei Wochen in Urlaub fährt, ohne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, wird die Uhr von unbekannten Dritten neben anderen Sachen des Beklagten aus dessen Wohnung gestohlen. Eine Versicherung hat der Beklagte nicht. Auf seiner Website ist nur ein Postfach angegeben, nicht seine Adresse.
Die Klägerin hat nun nach vorheriger erfolgloser Zahlungsaufforderung den Beklagten verklagt, an sie 9700 Euro als Schadensersatz zu zahlen. Die Schadenshöhe entspricht einer Schätzung eines auf Uhren spezialisierten Auktionshauses im Auftrag der Klägerin auf Grundlage eines Fotos von der Uhr. Mangels rechtzeitiger Verteidigungsanzeige im schriftlichen Vorverfahren wird der Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Einspruchsfrist läuft noch.
Aus der Klagebegründung ergibt sich, dass die Klägerin davon ausging, dass es sich beim Beklagten um einen gewerblich handelnden Uhrenspezialisten handelt. Sie verweist diesbezüglich auf die Website, wobei schon aus dem Vermerk des Anwalts hervorgeht, dass dieser Eindruck durch die Website gerade nicht vermittelt wird. Die Klägerin ging beim Vertragsschluss auch davon aus, den Beklagten nach der Reparatur zu vergüten. Sie ist der Ansicht, dass der Beklagte eine Treuepflicht in Form einer Schutz-/Aufklärungspflicht verletzt hat, weil er die Uhr weder gesichert lagerte, noch über eine Versicherung verfügte, noch die Klägerin hierüber aufklärte. Für einen Juwelier sei anerkannt, dass er entsprechende Pflichten habe - dann müsse das für den Beklagten auch gelten.
Der Beklagte ging beim Vertragsschluss ebenfalls davon aus, vergütet zu werden. Er fragt aber, ob es für ihn ggf. günstiger wäre, diesen Vortrag zurückzuhalten. Die beantragte Schadenshöhe irritiert ihn: Ein Sammlerfreund von ihm hatte den Wert der gestohlenen Uhr auf 2000 Euro geschätzt.
Vor dem Diebstahl hat der Beklagte noch für die Reparatur erforderliche Kleinteile bei einem Sammlerkollegen im Wert von 200 Euro gekauft, die er noch nicht eingebaut hatte. Diese waren bei offiziellen Händlern nicht zu erwerben gewesen.
Ohne Gewähr: Es gibt vermutlich mehrere richtige Lösungsansätze, wobei die Abgrenzung von Gefälligkeitsverhältnis und Rechtsbindungswillen sicher einen Schwerpunkt darstellte. Die Zurechnung des Vertreterwissens nach § 166 BGB war m. E. streitentscheidend. Bei Annahme von Unentgeltlichkeit war wohl § 690 BGB anzusprechen. Möglicherweise spielten die Hinweise der Klägerin auf § 472 HGB an. Neben dem Hauptsache- und dem PKH-Antrag war ein Antrag nach §§ 707, 719 ZPO zweckmäßig. Die hilfsweise Aufrechnung war im Schriftsatz zu erklären. Bei der Kostenfrage waren dann § 45 Abs. 3 GKG und § 344 ZPO anzusprechen und die Anlagen zum GKG/RVG.
Wow! Sehr ausführlich! Danke. Kann jemand bestätigen ob das auch so in Hessen lief? Im Mündlichen werden ab und an auch mal die aktuelle schriftlichen Examensthemen herangezogen… ich hoffe der nächste Durchgang macht das auch wieder so für euch! Lg
Ich selbst habe nicht mitgeschrieben, aber aus Erzählungen von meinem Freunden kam genau der gleiche Fall dran wie in Berlin
04.09.2024, 11:32
(04.09.2024, 11:19)HessenMai24 schrieb:Berlin und Hessen scheinen fast dieselbe Klausur geschrieben zu haben. In Hessen hat der Mandant aber keine Frage zu den Kosten oder einem Vergleich gestellt. Er wollte, dass das LG sich mit seinen Argumenten erstmals auseinandersetzt (--> Einspruch, weil bei Berufung OLG damit befasst gewesen wäre). Außerdem kam in Hessen nichts bezüglich der Gegenansprüche. Und in Hessen wurde der Wert der Uhr nicht bestritten, der wurde gutachterlich festgestellt und man sollte davon ausgehen, dass der Wert so angemessen berechnet war.(04.09.2024, 00:19)Dan(Hess) schrieb:(03.09.2024, 23:13)Gast(Berlin) schrieb: Sachverhalt Z2 in Berlin
Es handelt sich um eine Anwaltsklausur aus Beklagtensicht. Gegen den Mandanten ist bereits ein Versäumnisurteil ergangen (jedenfalls entspricht die Rechtsbehelfsbelehrung der eines VU), welches allerdings (entgegen § 313b Abs. 1 S. 2 ZPO) lediglich als "Urteil" bezeichnet ist.
Der Mandant will gegen das VU vorgehen, aber keine Instanz überspringen (Hinweis auf den Meistbegünstigungsgrundsatz). Gegenansprüche will er nur geltend machen, wenn er selbst zahlen muss, aber keine Klage oder Widerklage erheben. Er hat nur wenig Geld und muss noch sein Haus abbezahlen (-> PKH-Antrag). Der Mandant will außerdem wissen, welche Kosten ihm bei vollständigem Unterliegen blühen und welche Kosten auf ihn bei einem Vergleich über 2000 Euro mit entsprechender Kostenquotelung zukommen. Auszurechnen waren die Kosten nicht.
Der Beklagte ist Sammler und Liebhaber hochwertiger Uhren und repariert auch regelmäßig solche für Bekannte und Freunde, ohne von ihnen eine Vergütung zu verlangen. Beruflich ist er gelernter Zimmermann und als Aushilfe in einer Tischlerei tätig. Das Uhrenhandwerk hat er sich selbst beigebracht. Er betreibt eine Website, auf der er den Wert von Markenuhren schätzt, die teilweise ihm gehören und ihm teilweise auch fremd sind. Darauf weist er auf der Website auch hin. Außerdem steht auf der Startseite der Website einleitend, dass er Uhrensammler ist und Austausch mit Gleichgesinnten, insbesondere zum Thema Reparatur, sucht. Die Website beinhaltet auch AGB, wonach er für Beschädigungen und Verlust nicht haftet.
Die Klägerin ist Eigentümerin einer Uhr, die ein Erbstück ihres Vaters ist. Sie selbst kennt den Beklagten nicht. Der Kontakt zwischen den Parteien wird durch T vermittelt, der den Beklagten gut kennt und zwar keine Ahnung von Uhren hat, aber umfassende Kenntnis vom Hobby des Beklagten. Die Klägerin bittet T, ihre Uhr beim Beklagten in Reparatur zu geben und vertraut ihm im Übrigen den Vertragsschluss an; T bittet im Namen der Klägerin beim Beklagten darum, nach Möglichkeit die erforderlichen Ersatzteile zu besorgen und die Uhr zu reparieren. Eine Vergütung wird nicht vereinbart. Ein Hinweis auf die AGB erfolgt auch nicht.
Die Besorgung der Ersatzteile und die Reparatur soll einige Zeit in Anspruch nehmen, was der Beklagte den T auch bei der Übergabe der Uhr wissen lässt. Im Folgenden lagert die Uhr offen auf der Werkbank des Beklagten. Als dieser für zwei Wochen in Urlaub fährt, ohne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, wird die Uhr von unbekannten Dritten neben anderen Sachen des Beklagten aus dessen Wohnung gestohlen. Eine Versicherung hat der Beklagte nicht. Auf seiner Website ist nur ein Postfach angegeben, nicht seine Adresse.
Die Klägerin hat nun nach vorheriger erfolgloser Zahlungsaufforderung den Beklagten verklagt, an sie 9700 Euro als Schadensersatz zu zahlen. Die Schadenshöhe entspricht einer Schätzung eines auf Uhren spezialisierten Auktionshauses im Auftrag der Klägerin auf Grundlage eines Fotos von der Uhr. Mangels rechtzeitiger Verteidigungsanzeige im schriftlichen Vorverfahren wird der Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Einspruchsfrist läuft noch.
Aus der Klagebegründung ergibt sich, dass die Klägerin davon ausging, dass es sich beim Beklagten um einen gewerblich handelnden Uhrenspezialisten handelt. Sie verweist diesbezüglich auf die Website, wobei schon aus dem Vermerk des Anwalts hervorgeht, dass dieser Eindruck durch die Website gerade nicht vermittelt wird. Die Klägerin ging beim Vertragsschluss auch davon aus, den Beklagten nach der Reparatur zu vergüten. Sie ist der Ansicht, dass der Beklagte eine Treuepflicht in Form einer Schutz-/Aufklärungspflicht verletzt hat, weil er die Uhr weder gesichert lagerte, noch über eine Versicherung verfügte, noch die Klägerin hierüber aufklärte. Für einen Juwelier sei anerkannt, dass er entsprechende Pflichten habe - dann müsse das für den Beklagten auch gelten.
Der Beklagte ging beim Vertragsschluss ebenfalls davon aus, vergütet zu werden. Er fragt aber, ob es für ihn ggf. günstiger wäre, diesen Vortrag zurückzuhalten. Die beantragte Schadenshöhe irritiert ihn: Ein Sammlerfreund von ihm hatte den Wert der gestohlenen Uhr auf 2000 Euro geschätzt.
Vor dem Diebstahl hat der Beklagte noch für die Reparatur erforderliche Kleinteile bei einem Sammlerkollegen im Wert von 200 Euro gekauft, die er noch nicht eingebaut hatte. Diese waren bei offiziellen Händlern nicht zu erwerben gewesen.
Ohne Gewähr: Es gibt vermutlich mehrere richtige Lösungsansätze, wobei die Abgrenzung von Gefälligkeitsverhältnis und Rechtsbindungswillen sicher einen Schwerpunkt darstellte. Die Zurechnung des Vertreterwissens nach § 166 BGB war m. E. streitentscheidend. Bei Annahme von Unentgeltlichkeit war wohl § 690 BGB anzusprechen. Möglicherweise spielten die Hinweise der Klägerin auf § 472 HGB an. Neben dem Hauptsache- und dem PKH-Antrag war ein Antrag nach §§ 707, 719 ZPO zweckmäßig. Die hilfsweise Aufrechnung war im Schriftsatz zu erklären. Bei der Kostenfrage waren dann § 45 Abs. 3 GKG und § 344 ZPO anzusprechen und die Anlagen zum GKG/RVG.
Wow! Sehr ausführlich! Danke. Kann jemand bestätigen ob das auch so in Hessen lief? Im Mündlichen werden ab und an auch mal die aktuelle schriftlichen Examensthemen herangezogen… ich hoffe der nächste Durchgang macht das auch wieder so für euch! Lg
Ich selbst habe nicht mitgeschrieben, aber aus Erzählungen von meinem Freunden kam genau der gleiche Fall dran wie in Berlin
Ansonsten also anscheinend wie in Berlin. :)
04.09.2024, 11:47
Frage an die Hessen zum Bearbeitervermerk Z III: Musste man beim Schriftsatz an das Gericht auch den SV darstellen? Hatte den BV so verstanden, dass das nur beim Mandantenschreiben notwendig gewesen wäre.