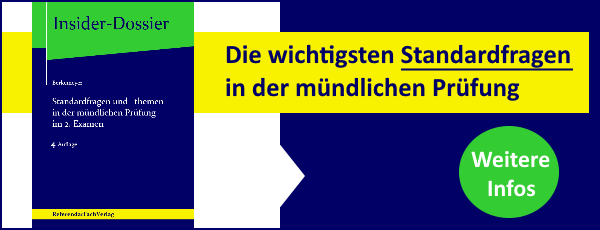06.10.2021, 07:57
Ich hab in der Zweckmäßigkeit die Einstweilige Verfügung geprüft und thematisiert und ein außergerichtliches Aufforderungsschreiben im praktischen Teil gemacht ohne Klage … ich dachte , da die Adresse des Gerichts nicht angegeben war, war das so angelegt…
06.10.2021, 08:00
(06.10.2021, 07:57)Juramol schrieb: Ich hab in der Zweckmäßigkeit die Einstweilige Verfügung geprüft und thematisiert und ein außergerichtliches Aufforderungsschreiben im praktischen Teil gemacht ohne Klage … ich dachte , da die Adresse des Gerichts nicht angegeben war, war das so angelegt…
Pauschalpreisvereinbarung war bei mir bindend und durch Erfüllung erloschen und weitere 10.000 Euro wegen Sittenwidrigkeit nicht zu verlangen, da finanzielle Zwangslage etc. offensichtlich ausgenutzt
06.10.2021, 08:34
Vorallem weil es ja auch noch keine Korrespondenz zwischen den Anwälten bisher gegeben hat, habe ich im praktischen Teil erstmal ein Aufforderungsschreiben mit Frist zur Rückgabe des Ofens veranlasst
06.10.2021, 08:52
(06.10.2021, 08:34)Juramol schrieb: Vorallem weil es ja auch noch keine Korrespondenz zwischen den Anwälten bisher gegeben hat, habe ich im praktischen Teil erstmal ein Aufforderungsschreiben mit Frist zur Rückgabe des Ofens veranlasst
Das ist doch eine gute Lösung! Und wohl auch praxisnäher....ich habe mich daran aufgehangen, dass die M ganz ganz sehr in finanziellen Schwierigkeiten steckt, Insolvenz droht und die Bestellungen aufliefen. Das klang mir zu sehr nach schnellem Rechtsschutz und außergerichtliche Schreiben hätten alles nur in die Länge gezogen bei hohen Verlusten und Kostenerhöhung.
06.10.2021, 08:56
(06.10.2021, 02:09)GPABremen schrieb: Ich habe den Herausgabeanspruch der Mandantin (mal unabhängig davon, wie das mit der GbR bzw. OHG nun ist) zunächst auf § 633 BGB gestützt.
1. Der Unternehmer bei einem Werkvertrag ist ja zur Herstellung des versprochenen Werkes (631 BGB) verpflichtet (hier also der Reparatur) und muss dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln verschaffen.
Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das kein eigener, vertraglicher Herausgabeanspruch sein soll. Lieg ich damit komplett falsch?
Immerhin prüft auch hier das OLG Hamm in einer Entscheidung einen Herausgabeanspruch des Bestellers gegen den Unternehmer nach § 631 BGB (https://openjur.de/u/100815.html). Ich hab zwar dummerweise nur § 633 als Anspruchsgrundlage, aber das geht hoffentlich als Flüchtigkeitsfehler durch :D
In einigen Lösungsskizzen von Universitäten (über Google) wird § 631 bzw. § 633 BGB auch vor § 985 BGB geprüft, leider in den von mir gefunden Lösungsskizzen aber abgelehnt, weil die Fälle allesamt einen anderen Eigentümer am Reparaturobjekt aufwiesen als den, der den Unternehmer mit der Reparatur beauftragt hat (Leasingfälle bei Fahrzeugreparatur). Aber § 631 prüfen die zumindest alle kurz an.
2. Im zweiten Schritt, also als zweiten möglichen Anspruch, habe ich dann aber auch § 985 BGB geprüft, wenn auch nur kurz, und bejaht.
Zuerst habe ich bei der Frage der Anwendung von § 985 neben vertraglichen Herausgabeansprüchen direkt auf die Lehre von der echten Anspruchskonkurrenz verwiesen (h.M) und den § 985 neben § 633 für anwendbar erklärt. Der Rest war dann relativ unproblematisch.
Ein Werkunternehmerpfandrecht als Recht zum Besitz habe ich aufgrund der bereits erfolgten Zahlung abgelehnt. Dem Werkvertrag nach handelte es sich bei der Vergütung von 6000 Euro um einen PauschalFESTbetrag. Eine Auslegung als Kostenvoranschlag habe ich abgelehnt, das war so klar formuliert, dass eine nachträgliche Erhöhung nicht infrage kommt. Darüber hinaus wäre eine Vergütungserhöhung um 10.000 Euro - selbst wenn man einen Kostenvoranschlag annehmen würde - zu hoch. Dafür sprach meiner Meinung nach auch die Darstellung des Elektromeisters in der Aussage der Mandantin ... der wurde ja in der Sachverhaltsdarstellung als "Raffzahn" bezeichnet, der grinsend mehr Geld gefordert hat und sogar betont hat, dass er wüsste, dass sie den Ofen dringend für das Geschäft braucht.
3. Die Aussage des Antragsgegners (einstweilige Verfügung) es bestünde ein Schadensersatzanspruch weil er dachte, er würde mit einer OHG einen Vertrag eingegangen sein und nicht mit einer GbR wusste ich überhaupt nicht zu verorten. Ich habe leider die OHG mangels notarieller Beurkundung verneint (hab mich leider verlesen) und habe die GbR bejaht, die durch die Kündigung jedoch in ein Einzelunternehmen übergegangen sei. So habe ich das Problem der Einordnung der GbR zwischen Kündigung und Auseinandersetzung nach Bauchgefühl gelöst. Ich finde zu dieser Frage weder einschlägige Urteile noch Kommentarstellen (weder in Palandt noch Müko) und auch in den Skripten von Kaiser und Alpmann (BGB mat. Recht) findet sich dazu nichts eindeutiges.
Ich gehe mal daher davon aus, dass man das mehr oder weniger frei diskutieren und entscheiden konnte. Für die Annahme einer GbR statt einer OHG spricht jedoch meiner Meinung nach, dass in RLP scheinbar die Klausur vorgab, dass es sich um eine GbR handelt. Außerdem spricht für eine GbR, dass die OHG nicht sofort gekündigt werden kann und dann der nicht auffindbare Mann vielmehr hätte problematisiert werden müssen.
Ob nun GbR oder OHG, ob nun durch die Mandantin als nat. Person oder durch Forführung der GbR bla bla ... das spielte an sich glaube ich nur eine Rolle für das Rubrum der Antragsschrift. Ich denke das war auch der Grund, weshalb im praktischen Teil das Rubrum nicht erlassen war, was ja echt nur Abschreibarbeit wäre. War mir aber egal, da ich das Rubrum eh nur mit mit "[...] Antragsstellerin gegen [...]" am Ende hinklatschen konnte, um noch schnell den Antrag vernünftig zu verfassen. Hab leider die genaue Bezeichnung des Ofens aus Zeitgründen nicht mehr hinbekommen, da steht also nur "Herausgabe des Ofens" ... aber ich denke mal, der Korrektor wird erkennen, dass es da nur an der Zeit mangelte (im Gutachten ist der Ofen richtig bezeichnet).
Dafür dürfte meine Zweckmäßigkeitsprüfung ganz gut gewesen sein, habe da glaube ich 7 oder 8 Erwägungen und ca. 3 Seiten geschrieben :D
Naja, euch eine gute Nacht, morgen einen erholten Tag und Donnerstag viel Glück bei Zwangsvollstreckungsrecht.
Das hört sich jedenfalls durchdachter an als meine Lösung, die ohne Umschweife einfach auf 985 gegangen ist.

Ich vermute, der Clou lag auch darin die beiden HerausgabeA zu differenzieren: einmal hatte die M/GbR/OHG eben schon Eigentum erlangt (Ofen) und einmal eben noch nicht (PC). Und man konnte den PC ja nicht über 985 lösen, weil noch gar keine Übereignung stattgefunden hat. Deshalb hab ich jetzt sehr sehr sehr Angst, dass mein undurchdachter Herausgabeanspruch zum PC aus 985 zum Durchfallen führt, weil ich das Abstraktionsprinzip verletzt/verkannt habe. Ei ei ei...

06.10.2021, 09:43
(06.10.2021, 08:56)GPA 2021 schrieb:(06.10.2021, 02:09)GPABremen schrieb: Ich habe den Herausgabeanspruch der Mandantin (mal unabhängig davon, wie das mit der GbR bzw. OHG nun ist) zunächst auf § 633 BGB gestützt.
1. Der Unternehmer bei einem Werkvertrag ist ja zur Herstellung des versprochenen Werkes (631 BGB) verpflichtet (hier also der Reparatur) und muss dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln verschaffen.
Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das kein eigener, vertraglicher Herausgabeanspruch sein soll. Lieg ich damit komplett falsch?
Immerhin prüft auch hier das OLG Hamm in einer Entscheidung einen Herausgabeanspruch des Bestellers gegen den Unternehmer nach § 631 BGB (https://openjur.de/u/100815.html). Ich hab zwar dummerweise nur § 633 als Anspruchsgrundlage, aber das geht hoffentlich als Flüchtigkeitsfehler durch :D
In einigen Lösungsskizzen von Universitäten (über Google) wird § 631 bzw. § 633 BGB auch vor § 985 BGB geprüft, leider in den von mir gefunden Lösungsskizzen aber abgelehnt, weil die Fälle allesamt einen anderen Eigentümer am Reparaturobjekt aufwiesen als den, der den Unternehmer mit der Reparatur beauftragt hat (Leasingfälle bei Fahrzeugreparatur). Aber § 631 prüfen die zumindest alle kurz an.
2. Im zweiten Schritt, also als zweiten möglichen Anspruch, habe ich dann aber auch § 985 BGB geprüft, wenn auch nur kurz, und bejaht.
Zuerst habe ich bei der Frage der Anwendung von § 985 neben vertraglichen Herausgabeansprüchen direkt auf die Lehre von der echten Anspruchskonkurrenz verwiesen (h.M) und den § 985 neben § 633 für anwendbar erklärt. Der Rest war dann relativ unproblematisch.
Ein Werkunternehmerpfandrecht als Recht zum Besitz habe ich aufgrund der bereits erfolgten Zahlung abgelehnt. Dem Werkvertrag nach handelte es sich bei der Vergütung von 6000 Euro um einen PauschalFESTbetrag. Eine Auslegung als Kostenvoranschlag habe ich abgelehnt, das war so klar formuliert, dass eine nachträgliche Erhöhung nicht infrage kommt. Darüber hinaus wäre eine Vergütungserhöhung um 10.000 Euro - selbst wenn man einen Kostenvoranschlag annehmen würde - zu hoch. Dafür sprach meiner Meinung nach auch die Darstellung des Elektromeisters in der Aussage der Mandantin ... der wurde ja in der Sachverhaltsdarstellung als "Raffzahn" bezeichnet, der grinsend mehr Geld gefordert hat und sogar betont hat, dass er wüsste, dass sie den Ofen dringend für das Geschäft braucht.
3. Die Aussage des Antragsgegners (einstweilige Verfügung) es bestünde ein Schadensersatzanspruch weil er dachte, er würde mit einer OHG einen Vertrag eingegangen sein und nicht mit einer GbR wusste ich überhaupt nicht zu verorten. Ich habe leider die OHG mangels notarieller Beurkundung verneint (hab mich leider verlesen) und habe die GbR bejaht, die durch die Kündigung jedoch in ein Einzelunternehmen übergegangen sei. So habe ich das Problem der Einordnung der GbR zwischen Kündigung und Auseinandersetzung nach Bauchgefühl gelöst. Ich finde zu dieser Frage weder einschlägige Urteile noch Kommentarstellen (weder in Palandt noch Müko) und auch in den Skripten von Kaiser und Alpmann (BGB mat. Recht) findet sich dazu nichts eindeutiges.
Ich gehe mal daher davon aus, dass man das mehr oder weniger frei diskutieren und entscheiden konnte. Für die Annahme einer GbR statt einer OHG spricht jedoch meiner Meinung nach, dass in RLP scheinbar die Klausur vorgab, dass es sich um eine GbR handelt. Außerdem spricht für eine GbR, dass die OHG nicht sofort gekündigt werden kann und dann der nicht auffindbare Mann vielmehr hätte problematisiert werden müssen.
Ob nun GbR oder OHG, ob nun durch die Mandantin als nat. Person oder durch Forführung der GbR bla bla ... das spielte an sich glaube ich nur eine Rolle für das Rubrum der Antragsschrift. Ich denke das war auch der Grund, weshalb im praktischen Teil das Rubrum nicht erlassen war, was ja echt nur Abschreibarbeit wäre. War mir aber egal, da ich das Rubrum eh nur mit mit "[...] Antragsstellerin gegen [...]" am Ende hinklatschen konnte, um noch schnell den Antrag vernünftig zu verfassen. Hab leider die genaue Bezeichnung des Ofens aus Zeitgründen nicht mehr hinbekommen, da steht also nur "Herausgabe des Ofens" ... aber ich denke mal, der Korrektor wird erkennen, dass es da nur an der Zeit mangelte (im Gutachten ist der Ofen richtig bezeichnet).
Dafür dürfte meine Zweckmäßigkeitsprüfung ganz gut gewesen sein, habe da glaube ich 7 oder 8 Erwägungen und ca. 3 Seiten geschrieben :D
Naja, euch eine gute Nacht, morgen einen erholten Tag und Donnerstag viel Glück bei Zwangsvollstreckungsrecht.
Das hört sich jedenfalls durchdachter an als meine Lösung, die ohne Umschweife einfach auf 985 gegangen ist.
Ich vermute, der Clou lag auch darin die beiden HerausgabeA zu differenzieren: einmal hatte die M/GbR/OHG eben schon Eigentum erlangt (Ofen) und einmal eben noch nicht (PC). Und man konnte den PC ja nicht über 985 lösen, weil noch gar keine Übereignung stattgefunden hat. Deshalb hab ich jetzt sehr sehr sehr Angst, dass mein undurchdachter Herausgabeanspruch zum PC aus 985 zum Durchfallen führt, weil ich das Abstraktionsprinzip verletzt/verkannt habe. Ei ei ei...
wenn die Korrektoren die Lösung sehen und dann nur Herausgabeansprüche aus Vertrag und 985 gefragt waren, dann gute Nacht :D. dann wird die Klausur als unterdurchschnittlich schwer eingeschätzt und jeder Fehler hart bestraft
06.10.2021, 10:39
(06.10.2021, 09:43)Gast schrieb:(06.10.2021, 08:56)GPA 2021 schrieb:(06.10.2021, 02:09)GPABremen schrieb: Ich habe den Herausgabeanspruch der Mandantin (mal unabhängig davon, wie das mit der GbR bzw. OHG nun ist) zunächst auf § 633 BGB gestützt.
1. Der Unternehmer bei einem Werkvertrag ist ja zur Herstellung des versprochenen Werkes (631 BGB) verpflichtet (hier also der Reparatur) und muss dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln verschaffen.
Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das kein eigener, vertraglicher Herausgabeanspruch sein soll. Lieg ich damit komplett falsch?
Immerhin prüft auch hier das OLG Hamm in einer Entscheidung einen Herausgabeanspruch des Bestellers gegen den Unternehmer nach § 631 BGB (https://openjur.de/u/100815.html). Ich hab zwar dummerweise nur § 633 als Anspruchsgrundlage, aber das geht hoffentlich als Flüchtigkeitsfehler durch :D
In einigen Lösungsskizzen von Universitäten (über Google) wird § 631 bzw. § 633 BGB auch vor § 985 BGB geprüft, leider in den von mir gefunden Lösungsskizzen aber abgelehnt, weil die Fälle allesamt einen anderen Eigentümer am Reparaturobjekt aufwiesen als den, der den Unternehmer mit der Reparatur beauftragt hat (Leasingfälle bei Fahrzeugreparatur). Aber § 631 prüfen die zumindest alle kurz an.
2. Im zweiten Schritt, also als zweiten möglichen Anspruch, habe ich dann aber auch § 985 BGB geprüft, wenn auch nur kurz, und bejaht.
Zuerst habe ich bei der Frage der Anwendung von § 985 neben vertraglichen Herausgabeansprüchen direkt auf die Lehre von der echten Anspruchskonkurrenz verwiesen (h.M) und den § 985 neben § 633 für anwendbar erklärt. Der Rest war dann relativ unproblematisch.
Ein Werkunternehmerpfandrecht als Recht zum Besitz habe ich aufgrund der bereits erfolgten Zahlung abgelehnt. Dem Werkvertrag nach handelte es sich bei der Vergütung von 6000 Euro um einen PauschalFESTbetrag. Eine Auslegung als Kostenvoranschlag habe ich abgelehnt, das war so klar formuliert, dass eine nachträgliche Erhöhung nicht infrage kommt. Darüber hinaus wäre eine Vergütungserhöhung um 10.000 Euro - selbst wenn man einen Kostenvoranschlag annehmen würde - zu hoch. Dafür sprach meiner Meinung nach auch die Darstellung des Elektromeisters in der Aussage der Mandantin ... der wurde ja in der Sachverhaltsdarstellung als "Raffzahn" bezeichnet, der grinsend mehr Geld gefordert hat und sogar betont hat, dass er wüsste, dass sie den Ofen dringend für das Geschäft braucht.
3. Die Aussage des Antragsgegners (einstweilige Verfügung) es bestünde ein Schadensersatzanspruch weil er dachte, er würde mit einer OHG einen Vertrag eingegangen sein und nicht mit einer GbR wusste ich überhaupt nicht zu verorten. Ich habe leider die OHG mangels notarieller Beurkundung verneint (hab mich leider verlesen) und habe die GbR bejaht, die durch die Kündigung jedoch in ein Einzelunternehmen übergegangen sei. So habe ich das Problem der Einordnung der GbR zwischen Kündigung und Auseinandersetzung nach Bauchgefühl gelöst. Ich finde zu dieser Frage weder einschlägige Urteile noch Kommentarstellen (weder in Palandt noch Müko) und auch in den Skripten von Kaiser und Alpmann (BGB mat. Recht) findet sich dazu nichts eindeutiges.
Ich gehe mal daher davon aus, dass man das mehr oder weniger frei diskutieren und entscheiden konnte. Für die Annahme einer GbR statt einer OHG spricht jedoch meiner Meinung nach, dass in RLP scheinbar die Klausur vorgab, dass es sich um eine GbR handelt. Außerdem spricht für eine GbR, dass die OHG nicht sofort gekündigt werden kann und dann der nicht auffindbare Mann vielmehr hätte problematisiert werden müssen.
Ob nun GbR oder OHG, ob nun durch die Mandantin als nat. Person oder durch Forführung der GbR bla bla ... das spielte an sich glaube ich nur eine Rolle für das Rubrum der Antragsschrift. Ich denke das war auch der Grund, weshalb im praktischen Teil das Rubrum nicht erlassen war, was ja echt nur Abschreibarbeit wäre. War mir aber egal, da ich das Rubrum eh nur mit mit "[...] Antragsstellerin gegen [...]" am Ende hinklatschen konnte, um noch schnell den Antrag vernünftig zu verfassen. Hab leider die genaue Bezeichnung des Ofens aus Zeitgründen nicht mehr hinbekommen, da steht also nur "Herausgabe des Ofens" ... aber ich denke mal, der Korrektor wird erkennen, dass es da nur an der Zeit mangelte (im Gutachten ist der Ofen richtig bezeichnet).
Dafür dürfte meine Zweckmäßigkeitsprüfung ganz gut gewesen sein, habe da glaube ich 7 oder 8 Erwägungen und ca. 3 Seiten geschrieben :D
Naja, euch eine gute Nacht, morgen einen erholten Tag und Donnerstag viel Glück bei Zwangsvollstreckungsrecht.
Das hört sich jedenfalls durchdachter an als meine Lösung, die ohne Umschweife einfach auf 985 gegangen ist.
Ich vermute, der Clou lag auch darin die beiden HerausgabeA zu differenzieren: einmal hatte die M/GbR/OHG eben schon Eigentum erlangt (Ofen) und einmal eben noch nicht (PC). Und man konnte den PC ja nicht über 985 lösen, weil noch gar keine Übereignung stattgefunden hat. Deshalb hab ich jetzt sehr sehr sehr Angst, dass mein undurchdachter Herausgabeanspruch zum PC aus 985 zum Durchfallen führt, weil ich das Abstraktionsprinzip verletzt/verkannt habe. Ei ei ei...
wenn die Korrektoren die Lösung sehen und dann nur Herausgabeansprüche aus Vertrag und 985 gefragt waren, dann gute Nacht :D. dann wird die Klausur als unterdurchschnittlich schwer eingeschätzt und jeder Fehler hart bestraft
So ein Quatsch. Das Auffinden der AGL wird vorausgesetzt bzw als leicht angesehen. Das sagt aber nichts über die Schwere der anschließenden Prüfung aus. Macht euch mal nicht verrückt
06.10.2021, 10:42
(06.10.2021, 10:39)Why schrieb:(06.10.2021, 09:43)Gast schrieb:(06.10.2021, 08:56)GPA 2021 schrieb:(06.10.2021, 02:09)GPABremen schrieb: Ich habe den Herausgabeanspruch der Mandantin (mal unabhängig davon, wie das mit der GbR bzw. OHG nun ist) zunächst auf § 633 BGB gestützt.
1. Der Unternehmer bei einem Werkvertrag ist ja zur Herstellung des versprochenen Werkes (631 BGB) verpflichtet (hier also der Reparatur) und muss dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln verschaffen.
Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das kein eigener, vertraglicher Herausgabeanspruch sein soll. Lieg ich damit komplett falsch?
Immerhin prüft auch hier das OLG Hamm in einer Entscheidung einen Herausgabeanspruch des Bestellers gegen den Unternehmer nach § 631 BGB (https://openjur.de/u/100815.html). Ich hab zwar dummerweise nur § 633 als Anspruchsgrundlage, aber das geht hoffentlich als Flüchtigkeitsfehler durch :D
In einigen Lösungsskizzen von Universitäten (über Google) wird § 631 bzw. § 633 BGB auch vor § 985 BGB geprüft, leider in den von mir gefunden Lösungsskizzen aber abgelehnt, weil die Fälle allesamt einen anderen Eigentümer am Reparaturobjekt aufwiesen als den, der den Unternehmer mit der Reparatur beauftragt hat (Leasingfälle bei Fahrzeugreparatur). Aber § 631 prüfen die zumindest alle kurz an.
2. Im zweiten Schritt, also als zweiten möglichen Anspruch, habe ich dann aber auch § 985 BGB geprüft, wenn auch nur kurz, und bejaht.
Zuerst habe ich bei der Frage der Anwendung von § 985 neben vertraglichen Herausgabeansprüchen direkt auf die Lehre von der echten Anspruchskonkurrenz verwiesen (h.M) und den § 985 neben § 633 für anwendbar erklärt. Der Rest war dann relativ unproblematisch.
Ein Werkunternehmerpfandrecht als Recht zum Besitz habe ich aufgrund der bereits erfolgten Zahlung abgelehnt. Dem Werkvertrag nach handelte es sich bei der Vergütung von 6000 Euro um einen PauschalFESTbetrag. Eine Auslegung als Kostenvoranschlag habe ich abgelehnt, das war so klar formuliert, dass eine nachträgliche Erhöhung nicht infrage kommt. Darüber hinaus wäre eine Vergütungserhöhung um 10.000 Euro - selbst wenn man einen Kostenvoranschlag annehmen würde - zu hoch. Dafür sprach meiner Meinung nach auch die Darstellung des Elektromeisters in der Aussage der Mandantin ... der wurde ja in der Sachverhaltsdarstellung als "Raffzahn" bezeichnet, der grinsend mehr Geld gefordert hat und sogar betont hat, dass er wüsste, dass sie den Ofen dringend für das Geschäft braucht.
3. Die Aussage des Antragsgegners (einstweilige Verfügung) es bestünde ein Schadensersatzanspruch weil er dachte, er würde mit einer OHG einen Vertrag eingegangen sein und nicht mit einer GbR wusste ich überhaupt nicht zu verorten. Ich habe leider die OHG mangels notarieller Beurkundung verneint (hab mich leider verlesen) und habe die GbR bejaht, die durch die Kündigung jedoch in ein Einzelunternehmen übergegangen sei. So habe ich das Problem der Einordnung der GbR zwischen Kündigung und Auseinandersetzung nach Bauchgefühl gelöst. Ich finde zu dieser Frage weder einschlägige Urteile noch Kommentarstellen (weder in Palandt noch Müko) und auch in den Skripten von Kaiser und Alpmann (BGB mat. Recht) findet sich dazu nichts eindeutiges.
Ich gehe mal daher davon aus, dass man das mehr oder weniger frei diskutieren und entscheiden konnte. Für die Annahme einer GbR statt einer OHG spricht jedoch meiner Meinung nach, dass in RLP scheinbar die Klausur vorgab, dass es sich um eine GbR handelt. Außerdem spricht für eine GbR, dass die OHG nicht sofort gekündigt werden kann und dann der nicht auffindbare Mann vielmehr hätte problematisiert werden müssen.
Ob nun GbR oder OHG, ob nun durch die Mandantin als nat. Person oder durch Forführung der GbR bla bla ... das spielte an sich glaube ich nur eine Rolle für das Rubrum der Antragsschrift. Ich denke das war auch der Grund, weshalb im praktischen Teil das Rubrum nicht erlassen war, was ja echt nur Abschreibarbeit wäre. War mir aber egal, da ich das Rubrum eh nur mit mit "[...] Antragsstellerin gegen [...]" am Ende hinklatschen konnte, um noch schnell den Antrag vernünftig zu verfassen. Hab leider die genaue Bezeichnung des Ofens aus Zeitgründen nicht mehr hinbekommen, da steht also nur "Herausgabe des Ofens" ... aber ich denke mal, der Korrektor wird erkennen, dass es da nur an der Zeit mangelte (im Gutachten ist der Ofen richtig bezeichnet).
Dafür dürfte meine Zweckmäßigkeitsprüfung ganz gut gewesen sein, habe da glaube ich 7 oder 8 Erwägungen und ca. 3 Seiten geschrieben :D
Naja, euch eine gute Nacht, morgen einen erholten Tag und Donnerstag viel Glück bei Zwangsvollstreckungsrecht.
Das hört sich jedenfalls durchdachter an als meine Lösung, die ohne Umschweife einfach auf 985 gegangen ist.
Ich vermute, der Clou lag auch darin die beiden HerausgabeA zu differenzieren: einmal hatte die M/GbR/OHG eben schon Eigentum erlangt (Ofen) und einmal eben noch nicht (PC). Und man konnte den PC ja nicht über 985 lösen, weil noch gar keine Übereignung stattgefunden hat. Deshalb hab ich jetzt sehr sehr sehr Angst, dass mein undurchdachter Herausgabeanspruch zum PC aus 985 zum Durchfallen führt, weil ich das Abstraktionsprinzip verletzt/verkannt habe. Ei ei ei...
wenn die Korrektoren die Lösung sehen und dann nur Herausgabeansprüche aus Vertrag und 985 gefragt waren, dann gute Nacht :D. dann wird die Klausur als unterdurchschnittlich schwer eingeschätzt und jeder Fehler hart bestraft
So ein Quatsch. Das Auffinden der AGL wird vorausgesetzt bzw als leicht angesehen. Das sagt aber nichts über die Schwere der anschließenden Prüfung aus. Macht euch mal nicht verrückt
Also falsche AGL = Wahrscheinlichkeit hoch durchzufallen?
06.10.2021, 12:07
(06.10.2021, 08:52)GPA 2021 schrieb:(06.10.2021, 08:34)Juramol schrieb: Vorallem weil es ja auch noch keine Korrespondenz zwischen den Anwälten bisher gegeben hat, habe ich im praktischen Teil erstmal ein Aufforderungsschreiben mit Frist zur Rückgabe des Ofens veranlasst
Das ist doch eine gute Lösung! Und wohl auch praxisnäher....ich habe mich daran aufgehangen, dass die M ganz ganz sehr in finanziellen Schwierigkeiten steckt, Insolvenz droht und die Bestellungen aufliefen. Das klang mir zu sehr nach schnellem Rechtsschutz und außergerichtliche Schreiben hätten alles nur in die Länge gezogen bei hohen Verlusten und Kostenerhöhung.
Ich würde auch sagen, dass hier zwingend ein Antrag auf einstw. Verfügung an das Gericht zu stellen war ODER ein Schreiben an die Mandantin (ich meine, das war so im Bearbeitervermerk eingegrenzt). Ein Schreiben an die gegnerische Partei war - wenn ich mich richtig erinnere - aufgrund der Aufgabenstellung und des Bearbeitervermerks nicht möglich und würde an sich ja auch dem Zweck des einstw. Rechtschutzes entgegenlaufen. Dafür spricht auch, dass der Bearbeitervermerk relativ deutlich die Begriffe "Rubrum" und "Anträge" betont hat.
Die Mandantin hat ja sehr deutlich gemacht, dass es schnell gehen muss. Die Zweckmäßigkeit verbietet ja im Prinzip regelrecht, nach der Bejahung von Erfolgsaussichten eines einstw. RS noch mit dem Gegner rumzuschreiben. Zumal der ja im Prinzip bereits abgelehnt hat, den Ofen herauszugeben, und auch schon eine Anwältin eingeschaltet hat.
Aber wer weiß das schon so genau. Ich kann mich auch komplett irren. So oder so lag der Schwerpunkt der Klausur hier meiner Meinung nach nicht zwingen nur im Schriftsatz im praktischen Teil, sodass ich mir da erstmal keine so großen Sorgen machen würde, solange du die einst. Verf. vernünftig durchgeprüft hast :)
06.10.2021, 12:14
(06.10.2021, 10:42)Gast2 schrieb:(06.10.2021, 10:39)Why schrieb:(06.10.2021, 09:43)Gast schrieb:(06.10.2021, 08:56)GPA 2021 schrieb:(06.10.2021, 02:09)GPABremen schrieb: Ich habe den Herausgabeanspruch der Mandantin (mal unabhängig davon, wie das mit der GbR bzw. OHG nun ist) zunächst auf § 633 BGB gestützt.
1. Der Unternehmer bei einem Werkvertrag ist ja zur Herstellung des versprochenen Werkes (631 BGB) verpflichtet (hier also der Reparatur) und muss dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln verschaffen.
Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das kein eigener, vertraglicher Herausgabeanspruch sein soll. Lieg ich damit komplett falsch?
Immerhin prüft auch hier das OLG Hamm in einer Entscheidung einen Herausgabeanspruch des Bestellers gegen den Unternehmer nach § 631 BGB (https://openjur.de/u/100815.html). Ich hab zwar dummerweise nur § 633 als Anspruchsgrundlage, aber das geht hoffentlich als Flüchtigkeitsfehler durch :D
In einigen Lösungsskizzen von Universitäten (über Google) wird § 631 bzw. § 633 BGB auch vor § 985 BGB geprüft, leider in den von mir gefunden Lösungsskizzen aber abgelehnt, weil die Fälle allesamt einen anderen Eigentümer am Reparaturobjekt aufwiesen als den, der den Unternehmer mit der Reparatur beauftragt hat (Leasingfälle bei Fahrzeugreparatur). Aber § 631 prüfen die zumindest alle kurz an.
2. Im zweiten Schritt, also als zweiten möglichen Anspruch, habe ich dann aber auch § 985 BGB geprüft, wenn auch nur kurz, und bejaht.
Zuerst habe ich bei der Frage der Anwendung von § 985 neben vertraglichen Herausgabeansprüchen direkt auf die Lehre von der echten Anspruchskonkurrenz verwiesen (h.M) und den § 985 neben § 633 für anwendbar erklärt. Der Rest war dann relativ unproblematisch.
Ein Werkunternehmerpfandrecht als Recht zum Besitz habe ich aufgrund der bereits erfolgten Zahlung abgelehnt. Dem Werkvertrag nach handelte es sich bei der Vergütung von 6000 Euro um einen PauschalFESTbetrag. Eine Auslegung als Kostenvoranschlag habe ich abgelehnt, das war so klar formuliert, dass eine nachträgliche Erhöhung nicht infrage kommt. Darüber hinaus wäre eine Vergütungserhöhung um 10.000 Euro - selbst wenn man einen Kostenvoranschlag annehmen würde - zu hoch. Dafür sprach meiner Meinung nach auch die Darstellung des Elektromeisters in der Aussage der Mandantin ... der wurde ja in der Sachverhaltsdarstellung als "Raffzahn" bezeichnet, der grinsend mehr Geld gefordert hat und sogar betont hat, dass er wüsste, dass sie den Ofen dringend für das Geschäft braucht.
3. Die Aussage des Antragsgegners (einstweilige Verfügung) es bestünde ein Schadensersatzanspruch weil er dachte, er würde mit einer OHG einen Vertrag eingegangen sein und nicht mit einer GbR wusste ich überhaupt nicht zu verorten. Ich habe leider die OHG mangels notarieller Beurkundung verneint (hab mich leider verlesen) und habe die GbR bejaht, die durch die Kündigung jedoch in ein Einzelunternehmen übergegangen sei. So habe ich das Problem der Einordnung der GbR zwischen Kündigung und Auseinandersetzung nach Bauchgefühl gelöst. Ich finde zu dieser Frage weder einschlägige Urteile noch Kommentarstellen (weder in Palandt noch Müko) und auch in den Skripten von Kaiser und Alpmann (BGB mat. Recht) findet sich dazu nichts eindeutiges.
Ich gehe mal daher davon aus, dass man das mehr oder weniger frei diskutieren und entscheiden konnte. Für die Annahme einer GbR statt einer OHG spricht jedoch meiner Meinung nach, dass in RLP scheinbar die Klausur vorgab, dass es sich um eine GbR handelt. Außerdem spricht für eine GbR, dass die OHG nicht sofort gekündigt werden kann und dann der nicht auffindbare Mann vielmehr hätte problematisiert werden müssen.
Ob nun GbR oder OHG, ob nun durch die Mandantin als nat. Person oder durch Forführung der GbR bla bla ... das spielte an sich glaube ich nur eine Rolle für das Rubrum der Antragsschrift. Ich denke das war auch der Grund, weshalb im praktischen Teil das Rubrum nicht erlassen war, was ja echt nur Abschreibarbeit wäre. War mir aber egal, da ich das Rubrum eh nur mit mit "[...] Antragsstellerin gegen [...]" am Ende hinklatschen konnte, um noch schnell den Antrag vernünftig zu verfassen. Hab leider die genaue Bezeichnung des Ofens aus Zeitgründen nicht mehr hinbekommen, da steht also nur "Herausgabe des Ofens" ... aber ich denke mal, der Korrektor wird erkennen, dass es da nur an der Zeit mangelte (im Gutachten ist der Ofen richtig bezeichnet).
Dafür dürfte meine Zweckmäßigkeitsprüfung ganz gut gewesen sein, habe da glaube ich 7 oder 8 Erwägungen und ca. 3 Seiten geschrieben :D
Naja, euch eine gute Nacht, morgen einen erholten Tag und Donnerstag viel Glück bei Zwangsvollstreckungsrecht.
Das hört sich jedenfalls durchdachter an als meine Lösung, die ohne Umschweife einfach auf 985 gegangen ist.
Ich vermute, der Clou lag auch darin die beiden HerausgabeA zu differenzieren: einmal hatte die M/GbR/OHG eben schon Eigentum erlangt (Ofen) und einmal eben noch nicht (PC). Und man konnte den PC ja nicht über 985 lösen, weil noch gar keine Übereignung stattgefunden hat. Deshalb hab ich jetzt sehr sehr sehr Angst, dass mein undurchdachter Herausgabeanspruch zum PC aus 985 zum Durchfallen führt, weil ich das Abstraktionsprinzip verletzt/verkannt habe. Ei ei ei...
wenn die Korrektoren die Lösung sehen und dann nur Herausgabeansprüche aus Vertrag und 985 gefragt waren, dann gute Nacht :D. dann wird die Klausur als unterdurchschnittlich schwer eingeschätzt und jeder Fehler hart bestraft
So ein Quatsch. Das Auffinden der AGL wird vorausgesetzt bzw als leicht angesehen. Das sagt aber nichts über die Schwere der anschließenden Prüfung aus. Macht euch mal nicht verrückt
Also falsche AGL = Wahrscheinlichkeit hoch durchzufallen?
§ 985 BGB ist ja keine falsche Anspruchsgrundlage für den Ofen. Meiner Meinung nach besteht primär ein Herausgabeanspruch aus Werkvertrag und daneben § 985. Aber das ist meine bescheidene Meinung. Kann auch falsch sein. Am Ende ist entscheidend, dass man etwaige Gegenansprüche des Elektromeisters vernünftig abhandelt. Ob nun in § 985 oder über den Werkvertrag direkt dürfte für die Benotung nur eine untergeordnete Rolle spielen, wenn der Rest sonst in Ordnung ist.
Beim PC hingegen hat noch keine Übereignung stattgefunden, auch wenn der Kaufpreis bereits entrichtet wurde. Es fehlt also noch die Übergabe und Übereignung, die nach § 433 laufen muss, hier war meiner Meinung nach der Schwerpunkt in der Diskussion, ob § 1357 BGB greift, und somit der Kaufvertrag auch für die Ehefrau gilt. Hier kann man sicherlich beides vertreten. Ich hab das aber auch nur noch hingeklatscht am Ende, weil einfach keine Zeit mehr war. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, ob der Ehemann damals den PC bestellt hat als Fertig-PC oder ob er ihn auf "eigene Zusammenstellung" vom Elektromeister hat zusammenbauen lassen. Ich meine es war nur eine einfache Fertig-Bestellung. Wenn nicht, dann hätte man noch an Abgrenzung der ganzen Kauflieferungswerksvertragsdingsbumse denken können ... wenn man ne Stunde mehr Zeit gehabt hätte ... :D