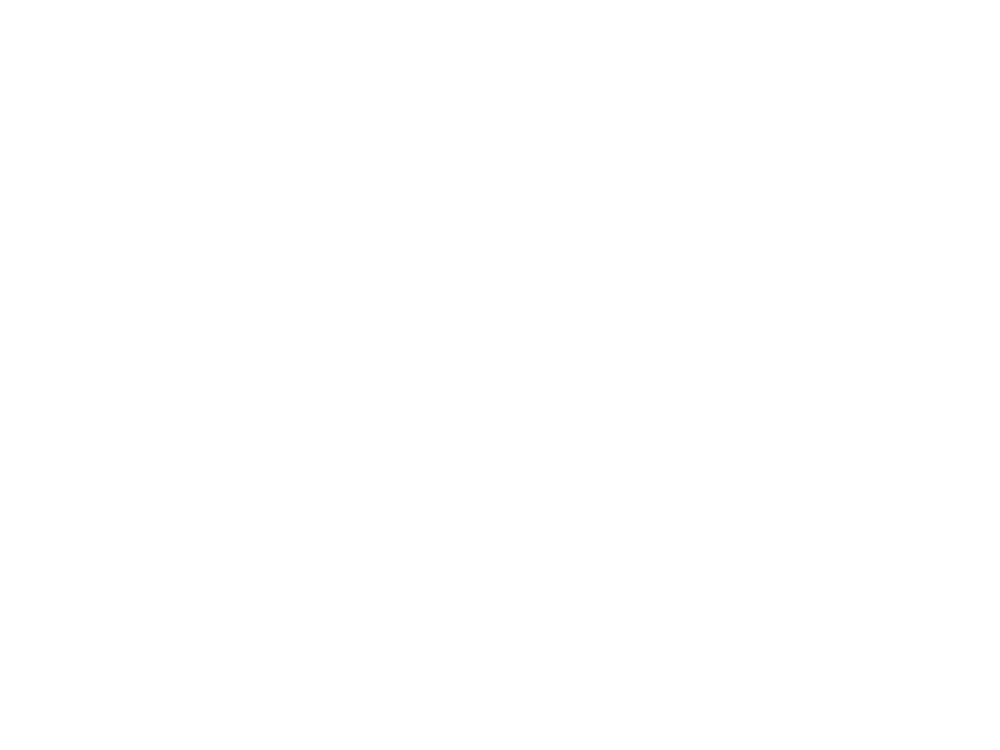11.03.2013, 14:06
Für alle, die sich über die Klausuren austauschen möchten, die im März geschrieben werden:
08.03. - Z1
11.03. - Z2
12.03. - Z3
14.03. - Z4
15.03. - S1
18.03. - S2
19.03. - V1
21.03. - V2
08.03. - Z1
11.03. - Z2
12.03. - Z3
14.03. - Z4
15.03. - S1
18.03. - S2
19.03. - V1
21.03. - V2
08.04.2013, 09:04
[/font]Der Kläger ist der Halter eines PKW, den er zur Sicherung des Darlehensvertrages an die Volkswagenbank übereignet hat. In dem § 1 des D-Vertrages ist geregelt, dass der Darlehensnehmer für den ordnungsgemäßen Zustand und die Reparaturen an dem PKW verantwortlich ist.
Die Ehefrau ist mit dem PKW in Ochtrup unterwegs und hat einen Unfall. Nach ihren Angaben fährt sie auf einer Geradeausspur. An der kommenden Kreuzung möchte sie links abbiegen. Aus diesem Grund wechselt sie bei dem Beginn der Linksabbiegerspur auf diese. Als sie weiter fährt, schert plötzlich das Fahrzeug der Beklagten ohne zu blinken über durchgezogene Linie nach links aus. Wollte auch wohl abbiegen. Es kommt zur Kollision. Die ganze rechte Seite des klägerischen PKWs ist beschädigt. Er bestellt einen Gutachter und dieser macht einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen iHv 1800- netto. Diese macht jetzt der Kläger im Namen der Bank als Eigentümerin des PKW geltend. Die Bank hat ihn dazu ausdrücklich ermächtigt. Dazu verlangt er für sich 175 € Gutachterkosten und 25 € Auslagenpauschale.
Die Beklagten sind Versicherung (B1), Halter des anderen PKW (B2) und Fahrer (B3).
Sie rügen die Zulässigkeit der Klage, da der Kläger die Ansprüche der Bank nicht einklagen darf. Er habe kein eigenes schutzwürdiges Interesse und es sei rechtsmissbräuchlich, da sie die Einwendungen, die sie ggü. dem Kläger als Halter vorhalten können, jetzt nicht erheben können (irgendwie so. Es war leider ein Satz, der über 7 Zeilen ging und sehr missverständlich formuliert war). Außerdem habe sich der Unfall anders ereignet: B2 und B3 sind auf der Geradeausspur gefahren. Bei Beginn der Linksabbiegerspur ist B3 auf die Spur gefahren. Die Ehefrau, die Drittwiderbeklagte ist, ist wohl hinter ihm gefahren. Noch bevor die Linkabbiegerspur begonnen hat, ist sie auf die Gegenfahrbahn gefahren, um B3 zu überholen. So ist es zur Kollision gekommen. Vollständiges Verschulden der Drittwiderbeklagten. Für den B3 war der Unfall ein unabwendbares Ereignis. Den Anspruch auf Gutachterkosten hat der Kläger nicht, weil das Gutachten nicht erforderlich war. Der Mitarbeiter der B1 hat ihm nach dem Unfall mitgeteilt, dass die B1 eigenes Gutachten erstellen lässt. Die Kosten der Reparatur sind unverhältnismäßig. Die Auslagenpauschale ist nicht konkretisiert. Hilfswiederklagend, für den Fall, dass sie doch haften, beantragen sie festzustellen, dass der Kläger und die Drittwiderbeklagte verpflichtet sind, in Höhe ihrer Haftungsquote aus dem ausgeurteilten Betrag sie ggü. der Bank freizustellen.
Der Kläger sagt, dass die Feststellungsklage unzulässig ist, weil kein Feststellungsinteresse besteht. Leistungsklage hat Vorrang und die Bezifferung des Antrags ist möglich. Die B's tragen vor, sie müssen noch klären, ob und welche Ansprüche ihnen gegen den Kläger und die Drittwiderbeklagte zustehen.
Es gibt eine mündliche Verhandlung. Die Drittwiderbeklagte Weiß nicht mehr, ob B3 geblinkt hat oder nicht. Ihr Spur war frei. Auf der Geradeausspur standen 3 Autos an der Ampel. Ob der B 3 schon stand, oder noch rollte, weiß sie nicht mehr. B2 hat gesagt, er habe nicht mitbekommen. Aber an der Unfallstelle habe die Drittwiderbeklagte den Überholvorgang zugegeben und sich entschuldigt. Der Kläger stellt den Überholvorgang als unglaubwürdig da. Es wird ein Sachverständigengutachten vom Gericht eingeholt. Der besagt, dass es zwar eine Kollision gab, aber die Unfallursache kann nicht festgestellt werden. Beide Varianten sind möglich. Die Parteien haben sich zum Gutachten nicht mehr geäußert. Die Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren.
[/size]
Die Ehefrau ist mit dem PKW in Ochtrup unterwegs und hat einen Unfall. Nach ihren Angaben fährt sie auf einer Geradeausspur. An der kommenden Kreuzung möchte sie links abbiegen. Aus diesem Grund wechselt sie bei dem Beginn der Linksabbiegerspur auf diese. Als sie weiter fährt, schert plötzlich das Fahrzeug der Beklagten ohne zu blinken über durchgezogene Linie nach links aus. Wollte auch wohl abbiegen. Es kommt zur Kollision. Die ganze rechte Seite des klägerischen PKWs ist beschädigt. Er bestellt einen Gutachter und dieser macht einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen iHv 1800- netto. Diese macht jetzt der Kläger im Namen der Bank als Eigentümerin des PKW geltend. Die Bank hat ihn dazu ausdrücklich ermächtigt. Dazu verlangt er für sich 175 € Gutachterkosten und 25 € Auslagenpauschale.
Die Beklagten sind Versicherung (B1), Halter des anderen PKW (B2) und Fahrer (B3).
Sie rügen die Zulässigkeit der Klage, da der Kläger die Ansprüche der Bank nicht einklagen darf. Er habe kein eigenes schutzwürdiges Interesse und es sei rechtsmissbräuchlich, da sie die Einwendungen, die sie ggü. dem Kläger als Halter vorhalten können, jetzt nicht erheben können (irgendwie so. Es war leider ein Satz, der über 7 Zeilen ging und sehr missverständlich formuliert war). Außerdem habe sich der Unfall anders ereignet: B2 und B3 sind auf der Geradeausspur gefahren. Bei Beginn der Linksabbiegerspur ist B3 auf die Spur gefahren. Die Ehefrau, die Drittwiderbeklagte ist, ist wohl hinter ihm gefahren. Noch bevor die Linkabbiegerspur begonnen hat, ist sie auf die Gegenfahrbahn gefahren, um B3 zu überholen. So ist es zur Kollision gekommen. Vollständiges Verschulden der Drittwiderbeklagten. Für den B3 war der Unfall ein unabwendbares Ereignis. Den Anspruch auf Gutachterkosten hat der Kläger nicht, weil das Gutachten nicht erforderlich war. Der Mitarbeiter der B1 hat ihm nach dem Unfall mitgeteilt, dass die B1 eigenes Gutachten erstellen lässt. Die Kosten der Reparatur sind unverhältnismäßig. Die Auslagenpauschale ist nicht konkretisiert. Hilfswiederklagend, für den Fall, dass sie doch haften, beantragen sie festzustellen, dass der Kläger und die Drittwiderbeklagte verpflichtet sind, in Höhe ihrer Haftungsquote aus dem ausgeurteilten Betrag sie ggü. der Bank freizustellen.
Der Kläger sagt, dass die Feststellungsklage unzulässig ist, weil kein Feststellungsinteresse besteht. Leistungsklage hat Vorrang und die Bezifferung des Antrags ist möglich. Die B's tragen vor, sie müssen noch klären, ob und welche Ansprüche ihnen gegen den Kläger und die Drittwiderbeklagte zustehen.
Es gibt eine mündliche Verhandlung. Die Drittwiderbeklagte Weiß nicht mehr, ob B3 geblinkt hat oder nicht. Ihr Spur war frei. Auf der Geradeausspur standen 3 Autos an der Ampel. Ob der B 3 schon stand, oder noch rollte, weiß sie nicht mehr. B2 hat gesagt, er habe nicht mitbekommen. Aber an der Unfallstelle habe die Drittwiderbeklagte den Überholvorgang zugegeben und sich entschuldigt. Der Kläger stellt den Überholvorgang als unglaubwürdig da. Es wird ein Sachverständigengutachten vom Gericht eingeholt. Der besagt, dass es zwar eine Kollision gab, aber die Unfallursache kann nicht festgestellt werden. Beide Varianten sind möglich. Die Parteien haben sich zum Gutachten nicht mehr geäußert. Die Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren.
[/size]
08.04.2013, 09:10
[/font]Es geht um anwaltliche Beratung aus Beklagtensicht. Der Mandant ist ein Architekt, der mit dem Kläger einen Vollarchitektenvertrag im Jahr 2006 geschlossen hatte. Es ging um den Bau des Hauses in Düsseldorf. In den Vertag wurden die HOAI mit einbezogen. Der Mandant beauftragte mit der Ausführung der Außenabdichtungsarbeiten die MFG GmbH. Er erklärte den Mitarbeitern die Vorgehensweise und noch bevor es mit der Arbeiten begonnen wurde, fuhr der Mandant für 14 Tage in den Urlaub. Nachdem der Bau fertig war, wurden die Arbeiten durch den Kläger zunächst der MFG GmbH abgenommen. Am 20.05.2008 wurde dann der Mandant bezahlt und auch seine Tätigkeit abgenommen. Kurze Zeit später beschwerte sich der Kläger über die Feuchtigkeit im Keller.
Im Jahr 2008 verklagte er die MFG GmbH auf Zahlung von 32.000 € wegen Mängelbeseitigung. Es gab eine Sachverständigenuntersuchung am Haus, die feststellte, dass die vorgeschriebene Mindestabdichtung von 3 mm unterschritten wurde und durchgehend 1-2 mm ist. Die neue fachmännische Außenabdichtung würde 34.000 € brutto kosten. Während des Prozesses verkündete der Kläger dem Mandanten den Streit. Die Begründung war, dass es einen Vertrag zwischen dem Kläger und dem Streitverkündungsempfänger gab und dieser seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Wenn die MFG GmbH zur Zahlung verurteilt wird, so haftet auch der Streitverkündungsempfänger, also der Mandant, mit der GmbH gesamtschuldnerisch ggü. dem Kläger. Trotz Bedenken bzgl. der Wirksamkeit der Streitverkündung ist der Mandant dem Streit auf Seiten des Klägers beigetreten. Die GmbH wurde dann zur Zahlung verurteilt. Er forderte die GmbH und den Mandanten auf, die Mängel zu beseitigen. Da sie nicht tätig geworden sind, hat er einen Dritten mit der Beseitigung beauftrag und dafür 52.300 € bezahlt. Die Vollstreckung bei der GmbH war erfolglos.
Jetzt hat der Kläger gegen den Mandanten eine Klage auf Zahlung von 52.300 € erhoben. Der Mandant hat die Verteidigungsbereitschaft angezeigt, es erging aber ein VU am 18.02.13 gegen ihn. Zustellung an ihn am 22.02.12, ab den Klägervertreter am 23.02.13.
Der Mandant möchte sich gegen den VU wehren. Er meint, er könne doch nicht 24 Stunden die Arbeiten überwachen. Urlaub sei doch wohl ihm gestattet. Weiterhin bestreitet er die Mängel der Abdichtung. Der Sachverständige habe falsch die Dichte gemessen. Er sei sich sicher, dass die Abdichtung 5 mm sei. Weiterhin sei der Anspruch zu hoch. Er habe drei Angebote eingeholt und sie belaufen sich alle auf 41.000 €. Dazu kann ihm doch nicht ein Strick daraus gedreht werden, dass er dem vorherigen Streit beigetreten ist.
Weiterhin möchte er wissen, ob er gegen die GmbH vorgehen kann, wenn er zur Zahlung oder zur teilweisen Zahlung verurteilt wird. Begutachtungszeitpunkt ist 11.03.13. Der Klausur war ein Auszug aus § 15 HOAI beigefügt.
Im Jahr 2008 verklagte er die MFG GmbH auf Zahlung von 32.000 € wegen Mängelbeseitigung. Es gab eine Sachverständigenuntersuchung am Haus, die feststellte, dass die vorgeschriebene Mindestabdichtung von 3 mm unterschritten wurde und durchgehend 1-2 mm ist. Die neue fachmännische Außenabdichtung würde 34.000 € brutto kosten. Während des Prozesses verkündete der Kläger dem Mandanten den Streit. Die Begründung war, dass es einen Vertrag zwischen dem Kläger und dem Streitverkündungsempfänger gab und dieser seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Wenn die MFG GmbH zur Zahlung verurteilt wird, so haftet auch der Streitverkündungsempfänger, also der Mandant, mit der GmbH gesamtschuldnerisch ggü. dem Kläger. Trotz Bedenken bzgl. der Wirksamkeit der Streitverkündung ist der Mandant dem Streit auf Seiten des Klägers beigetreten. Die GmbH wurde dann zur Zahlung verurteilt. Er forderte die GmbH und den Mandanten auf, die Mängel zu beseitigen. Da sie nicht tätig geworden sind, hat er einen Dritten mit der Beseitigung beauftrag und dafür 52.300 € bezahlt. Die Vollstreckung bei der GmbH war erfolglos.
Jetzt hat der Kläger gegen den Mandanten eine Klage auf Zahlung von 52.300 € erhoben. Der Mandant hat die Verteidigungsbereitschaft angezeigt, es erging aber ein VU am 18.02.13 gegen ihn. Zustellung an ihn am 22.02.12, ab den Klägervertreter am 23.02.13.
Der Mandant möchte sich gegen den VU wehren. Er meint, er könne doch nicht 24 Stunden die Arbeiten überwachen. Urlaub sei doch wohl ihm gestattet. Weiterhin bestreitet er die Mängel der Abdichtung. Der Sachverständige habe falsch die Dichte gemessen. Er sei sich sicher, dass die Abdichtung 5 mm sei. Weiterhin sei der Anspruch zu hoch. Er habe drei Angebote eingeholt und sie belaufen sich alle auf 41.000 €. Dazu kann ihm doch nicht ein Strick daraus gedreht werden, dass er dem vorherigen Streit beigetreten ist.
Weiterhin möchte er wissen, ob er gegen die GmbH vorgehen kann, wenn er zur Zahlung oder zur teilweisen Zahlung verurteilt wird. Begutachtungszeitpunkt ist 11.03.13. Der Klausur war ein Auszug aus § 15 HOAI beigefügt.
08.04.2013, 09:12
Die Klägerin erhebt die Klage vor dem LG Düsseldorf und beantragt die Zwangsvollstreckung aus dem Berufungsurteil des OLG Düsseldorf für unzulässig zu erklären.
Die Klägerin kaufte von der Beklagten, einer Lederwaren GmbH, eine Polstergarnitur zum Preis von 12.000 € im August 2012. Aufgrund der Streitigkeit bzgl. des von der Klägerin am 1.09.2012 erklärten Rücktritts vom KV landeten die Parteien vor Gericht. Das LG Düsseldorf wies die Klage der jetzigen Beklagten auf Zahlung des Kaufpreises ab, da das Gericht den Rücktritt für wirksam erklärte. Auf die Berufung der Beklagten änderte das OLG Düsseldorf am 5.12.2012 das Urteil des LG und verurteilte die Klägerin zur Zahlung von 12.000 € Zug um Zug gegen die Lieferung der Polstergarnitur. Zusätzlich stellte das Gericht den Annahmeverzug der Klägerin fest. In der teilweise abgedruckten Entscheidung hieß es, dass der Rücktritt der Klägerin unwirksam war, weil die Beklagte ihre Lieferungsplicht nicht verletzt hatte. Die Klägerin setzt der Beklagten nach dem Vertragsabschluss eine Lieferfrist bis zum 31.08.2012 und trat dann am 1.09.2012 zurück. In der Bestellung und in der Auftragsbestätigung war jedoch als Liefertermin "September 2012" angegeben. Das Berufungsgericht hat dies als eine wirksame Fristvereinbarung erachtet und daher die Pflichtverletzung verneint. Weiterhin hat er die hilfsweise Aufrechnung der Klägerin, die sie das erste Mal in der Berufung erklärt hatte, abgewiesen, weil der Grund und die Höhe der Gegenforderung zwischen der Parteien streitig war. Weiterhin erfolgte die Verurteilung nur Zug um Zug, weil die Klägerin keine Anzahlung iHv 2.000 e der Beklagten schuldete. In der Bestellung hieß es, dass die Lieferung nur nach Anzahlung von 2.000 € erfolgt. In der Auftragsbestätigung hieß es, dass der Preis 12.000 € beträgt und bei der Lieferung zu entrichten ist. Das Berufungsgericht ist zum Ergebnis gekommen, dass die Parteien keine Anzahlung vereinbart haben und daher nur eine vollständige KP zu entrichten ist.
Nachdem das Urteil der Klägerin persönlich am 18.12.12 zugestellt wurde, zeigte sie ggü. der Beklagten und ihrem Prozessbevollmächtigten die Bereitschaft, den KP zu zahlen und die Garnitur abzunehmen. Sie setzte der Beklagten eine Lieferungsfrist bis zum 11.01.2012. Die Schreiben sind per Bote der Gegenseite am 22.12.2012 zugegangen. Am 24.01.13 erkläre die Klägerin nur ggü. der Beklagten erneut den Rücktritt vom Kaufvertrag wegen Nichtlieferung. Am 29.01.13 meldete sich der Beklagtenvertreter und meinte, die Beklagte sei an die Lieferfrist nicht gebunden. Er drohte die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ab dem 22.03.13.
Die Klägerin hat am 4.02.13 Klage erhoben.
Die Beklagte meint, der Klägerin fehle das Rechtsschutzbedürfnis, da die Zustellung des Urteils unwirksam sei und deswegen die Klägerin immer noch die Nichtzulassungsbeschwerde erheben kann.
Weiterhin kann die Klägerin nicht schon wieder vom Vertrag zurück treten. Vor allem, weil sie sich im Annahmeverzug befindet.
Auch die Lieferfrist sei zu kurz bemessen. die Polstergarnitur, die seit September 2012 ablieferbereit ist, kann nur per Fracht geliefert werden. Deswegen können keine kurzfristigen Lieferungen erfolgen. Es muss ein geeigneter Frachtführer gefunden werden. Eine übliche Lieferzeit in der Möbelbranche europaweit seien 6 Wochen. Weiterhin erfolgte die Fristsetzung in der Feiertagszeit, wo Betriebsferien waren und nur wenig Personal da war. Und der Rücktritt sei nur der Beklagten ggü. erklärt worden, obwohl die Klägerin wusste, dass die Beklagte von dem Prozessbevollmächtigten vertreten wird.
DI Klägerin hat vorgetragen, dass zwar ihr das Urteil am 18.12.2012 zugestellt wurde, aber sie das Urteil dem Prozessbevollmächtigten schon am 20.12.2012 im Original vorgelegt hatte. Hilfsweise, für die Unwirksamkeit des Rücktritts, rechnet die Klägerin mit einem Schadensersatz aufgrund Mängel an einem Sitzgarnitur. Der Kauf erfolgte im Jahr 2007. In der mündlichen Verhandlung bestreitet die Beklagte die Mängel. Sie bestreitet den Anspruch dem Grunde und der Höhe nach und macht Verjährung geltend. Die Klägerin sagt, die Beklagte habe auf die Einrede der Verjährung verzichtet.
Die Klägerin kaufte von der Beklagten, einer Lederwaren GmbH, eine Polstergarnitur zum Preis von 12.000 € im August 2012. Aufgrund der Streitigkeit bzgl. des von der Klägerin am 1.09.2012 erklärten Rücktritts vom KV landeten die Parteien vor Gericht. Das LG Düsseldorf wies die Klage der jetzigen Beklagten auf Zahlung des Kaufpreises ab, da das Gericht den Rücktritt für wirksam erklärte. Auf die Berufung der Beklagten änderte das OLG Düsseldorf am 5.12.2012 das Urteil des LG und verurteilte die Klägerin zur Zahlung von 12.000 € Zug um Zug gegen die Lieferung der Polstergarnitur. Zusätzlich stellte das Gericht den Annahmeverzug der Klägerin fest. In der teilweise abgedruckten Entscheidung hieß es, dass der Rücktritt der Klägerin unwirksam war, weil die Beklagte ihre Lieferungsplicht nicht verletzt hatte. Die Klägerin setzt der Beklagten nach dem Vertragsabschluss eine Lieferfrist bis zum 31.08.2012 und trat dann am 1.09.2012 zurück. In der Bestellung und in der Auftragsbestätigung war jedoch als Liefertermin "September 2012" angegeben. Das Berufungsgericht hat dies als eine wirksame Fristvereinbarung erachtet und daher die Pflichtverletzung verneint. Weiterhin hat er die hilfsweise Aufrechnung der Klägerin, die sie das erste Mal in der Berufung erklärt hatte, abgewiesen, weil der Grund und die Höhe der Gegenforderung zwischen der Parteien streitig war. Weiterhin erfolgte die Verurteilung nur Zug um Zug, weil die Klägerin keine Anzahlung iHv 2.000 e der Beklagten schuldete. In der Bestellung hieß es, dass die Lieferung nur nach Anzahlung von 2.000 € erfolgt. In der Auftragsbestätigung hieß es, dass der Preis 12.000 € beträgt und bei der Lieferung zu entrichten ist. Das Berufungsgericht ist zum Ergebnis gekommen, dass die Parteien keine Anzahlung vereinbart haben und daher nur eine vollständige KP zu entrichten ist.
Nachdem das Urteil der Klägerin persönlich am 18.12.12 zugestellt wurde, zeigte sie ggü. der Beklagten und ihrem Prozessbevollmächtigten die Bereitschaft, den KP zu zahlen und die Garnitur abzunehmen. Sie setzte der Beklagten eine Lieferungsfrist bis zum 11.01.2012. Die Schreiben sind per Bote der Gegenseite am 22.12.2012 zugegangen. Am 24.01.13 erkläre die Klägerin nur ggü. der Beklagten erneut den Rücktritt vom Kaufvertrag wegen Nichtlieferung. Am 29.01.13 meldete sich der Beklagtenvertreter und meinte, die Beklagte sei an die Lieferfrist nicht gebunden. Er drohte die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ab dem 22.03.13.
Die Klägerin hat am 4.02.13 Klage erhoben.
Die Beklagte meint, der Klägerin fehle das Rechtsschutzbedürfnis, da die Zustellung des Urteils unwirksam sei und deswegen die Klägerin immer noch die Nichtzulassungsbeschwerde erheben kann.
Weiterhin kann die Klägerin nicht schon wieder vom Vertrag zurück treten. Vor allem, weil sie sich im Annahmeverzug befindet.
Auch die Lieferfrist sei zu kurz bemessen. die Polstergarnitur, die seit September 2012 ablieferbereit ist, kann nur per Fracht geliefert werden. Deswegen können keine kurzfristigen Lieferungen erfolgen. Es muss ein geeigneter Frachtführer gefunden werden. Eine übliche Lieferzeit in der Möbelbranche europaweit seien 6 Wochen. Weiterhin erfolgte die Fristsetzung in der Feiertagszeit, wo Betriebsferien waren und nur wenig Personal da war. Und der Rücktritt sei nur der Beklagten ggü. erklärt worden, obwohl die Klägerin wusste, dass die Beklagte von dem Prozessbevollmächtigten vertreten wird.
DI Klägerin hat vorgetragen, dass zwar ihr das Urteil am 18.12.2012 zugestellt wurde, aber sie das Urteil dem Prozessbevollmächtigten schon am 20.12.2012 im Original vorgelegt hatte. Hilfsweise, für die Unwirksamkeit des Rücktritts, rechnet die Klägerin mit einem Schadensersatz aufgrund Mängel an einem Sitzgarnitur. Der Kauf erfolgte im Jahr 2007. In der mündlichen Verhandlung bestreitet die Beklagte die Mängel. Sie bestreitet den Anspruch dem Grunde und der Höhe nach und macht Verjährung geltend. Die Klägerin sagt, die Beklagte habe auf die Einrede der Verjährung verzichtet.
08.04.2013, 09:13
Der Mandant begehrt die Überprüfung der Erfolgsaussichten der Berufung.
Er ist Pferdezüchter und Eigentümer des Pferdes. Der Beklagte, der auch ein eigenes Pferd im gleichen Stall stehen hat und ein Berufsreiter ist, fragte im Jahr 2011 bei dem Stallinhaber nach, ob er das Pferd des Mandanten für das Reitturnier in Italien ausleihen könnte, da sein eigenes Pferd verletzt war. Der S sagte ihm, er muss den Mandanten fragen, da dieser der Eigentümer ist. Nachdem der Mandant damit einverstanden war, vereinbarte des S für den Mandanten und der Beklagte einen Vertag. Der Beklagte musste dabei die Kosten des Turniers selber tragen, durfte aber im Fall der Auszahlung des Preisgeldes die Turnierkosten verrechnen. Im Übrigen würden die Regeln über Reitsport (FEI) einbezogen. Im Art. 128 steht, dass die Gewinngelder dem Eigentümer des Pferdes gehören. Die Reiter erhalten Pokale, wenn diese auch für reiter vorgesehen sind.
Nachdem der Beklagte erfolgreich das Turnier gewann und das Pferd zurück brachte, hat der Mandant erfahren, dass dem Beklagten ein Preisgeld iHv 31.500€ bar ausgezahlt wurde. Er forderte den Beklagten das Geld herauszugeben. Der Beklagte weigerte sich. Der Kläger hat die Klage vor dem LG Paderborn erhoben. Er hat vorgetragen, dass der Beklagte auch schon im Jahr 2010 von ihm ein Pferd geliehen hatte und auch da die FEI galten. Weiterhin ist es auch Gewohnheit, dass die Reiter für die Eigentümer die Preisgelder erhalten und diese dann an die Eigentümer weitergeben, da Eigentümer regelmäßig nicht an den Turnieren Teil nehmen. Der Kläger habe zwar das Pferd irgendwann an Frau v.B. verkauft, aber im Jahr 2010 dieses wieder zurück gekauft und bei dem S untergebracht.
Der Beklagte meinte, dass die Klage unzulässig sei. Er sei israelischer Staatsangehöriger und deswegen israelische Gerichte für den Streit zuständig. Weiterhin sei er in ein anderes Gerichtsbezirk am Tag der Klageerwiderung umgezogen. Der Beklagte hat auch vorgetragen, die FEI waren in die Vereinbarung nicht mit einbezogen. Weiterhin stehe ihm das Geld zu, da er der Eigentümer sei. Kurz nachdem er wieder zurück war, habe er das Pferd von S gekauft. Hilfsweise rechne er mit der Forderung bzgl. der Turnierkosten auf. Weiterhin rechne er mit der Forderung aufgrund der Wertsteigerung des Pferdes auf. Er habe durch die Teilnahme am Turnier die Qualität des Pferdes gesteigert und das Pferd sei jetzt deutlich viel mehr wert. Der Mandant hat vorgetragen, dass der Beklagte das Pferd vor dem Wettbewerb nicht zusätzlich beritten habe und das Pferd schon vor dem Turnier die Qualität besaß.
Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Dem Kläger stehe kein Anspruch zu, weil keine AGL ersichtlich ist.
Das Urteil wurde dem Mandanten persönlich am 7.02.13 zugestellt. Seiner Anwältin hat er das Urteil am 19.02.13 vorgelegt. Sie hat ihm geraten, sich mit dem Urteil abzufinden, weil die Berufung aussichtslos ist. Der Mandant hat ihr darauf das Mandat gekündigt.
Als praktischer Teil war entweder die Berufungsbegründungsschrift oder ein Schreiben an den Mandanten zu fertigen.
Er ist Pferdezüchter und Eigentümer des Pferdes. Der Beklagte, der auch ein eigenes Pferd im gleichen Stall stehen hat und ein Berufsreiter ist, fragte im Jahr 2011 bei dem Stallinhaber nach, ob er das Pferd des Mandanten für das Reitturnier in Italien ausleihen könnte, da sein eigenes Pferd verletzt war. Der S sagte ihm, er muss den Mandanten fragen, da dieser der Eigentümer ist. Nachdem der Mandant damit einverstanden war, vereinbarte des S für den Mandanten und der Beklagte einen Vertag. Der Beklagte musste dabei die Kosten des Turniers selber tragen, durfte aber im Fall der Auszahlung des Preisgeldes die Turnierkosten verrechnen. Im Übrigen würden die Regeln über Reitsport (FEI) einbezogen. Im Art. 128 steht, dass die Gewinngelder dem Eigentümer des Pferdes gehören. Die Reiter erhalten Pokale, wenn diese auch für reiter vorgesehen sind.
Nachdem der Beklagte erfolgreich das Turnier gewann und das Pferd zurück brachte, hat der Mandant erfahren, dass dem Beklagten ein Preisgeld iHv 31.500€ bar ausgezahlt wurde. Er forderte den Beklagten das Geld herauszugeben. Der Beklagte weigerte sich. Der Kläger hat die Klage vor dem LG Paderborn erhoben. Er hat vorgetragen, dass der Beklagte auch schon im Jahr 2010 von ihm ein Pferd geliehen hatte und auch da die FEI galten. Weiterhin ist es auch Gewohnheit, dass die Reiter für die Eigentümer die Preisgelder erhalten und diese dann an die Eigentümer weitergeben, da Eigentümer regelmäßig nicht an den Turnieren Teil nehmen. Der Kläger habe zwar das Pferd irgendwann an Frau v.B. verkauft, aber im Jahr 2010 dieses wieder zurück gekauft und bei dem S untergebracht.
Der Beklagte meinte, dass die Klage unzulässig sei. Er sei israelischer Staatsangehöriger und deswegen israelische Gerichte für den Streit zuständig. Weiterhin sei er in ein anderes Gerichtsbezirk am Tag der Klageerwiderung umgezogen. Der Beklagte hat auch vorgetragen, die FEI waren in die Vereinbarung nicht mit einbezogen. Weiterhin stehe ihm das Geld zu, da er der Eigentümer sei. Kurz nachdem er wieder zurück war, habe er das Pferd von S gekauft. Hilfsweise rechne er mit der Forderung bzgl. der Turnierkosten auf. Weiterhin rechne er mit der Forderung aufgrund der Wertsteigerung des Pferdes auf. Er habe durch die Teilnahme am Turnier die Qualität des Pferdes gesteigert und das Pferd sei jetzt deutlich viel mehr wert. Der Mandant hat vorgetragen, dass der Beklagte das Pferd vor dem Wettbewerb nicht zusätzlich beritten habe und das Pferd schon vor dem Turnier die Qualität besaß.
Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Dem Kläger stehe kein Anspruch zu, weil keine AGL ersichtlich ist.
Das Urteil wurde dem Mandanten persönlich am 7.02.13 zugestellt. Seiner Anwältin hat er das Urteil am 19.02.13 vorgelegt. Sie hat ihm geraten, sich mit dem Urteil abzufinden, weil die Berufung aussichtslos ist. Der Mandant hat ihr darauf das Mandat gekündigt.
Als praktischer Teil war entweder die Berufungsbegründungsschrift oder ein Schreiben an den Mandanten zu fertigen.
08.04.2013, 09:14
Am 6.02. gegen 18 Uhr ging auf der Leitstelle in Düsseldorf ein Anruf ein. Der anonyme Anrufer teilte mit, dass er gerade eine Frau in der Wohnung in Düsseldorf getötet hatte. Er hat sich aber korrigiert und gesagt, dass diese noch lebe, aber schwer verletzt sei und verbluten werde, wenn die Hilfe schnell käme. Danach hat er aufgelegt. Als die Beamten am Ort eintrafen, waren schon zwei weitere Streifen und ein Rettungswagen da. Es stelle sich heraus, dass ein Beamter eine Frau schreien hörte und die verschlossene Tür aufbrechen musste. Als die Beamten in die Wohnung kamen, fanden sie in der Küche ein Frau am Boden mit Blut überströmt und einen Mann (Beschuldigten), der am Küchentisch regungslos saß und ein blutiges Messer in der Hand hielt. In einem anderen Zimmer saß eine weitere Frau, die an der Hand verletzt war und schrie. Der B ließ sich widerstandlos festnehmen. Das Messer, welches ein Küchenmesser war, wurde sichergestellt. Die Geschädigte AR wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie am gleichen Abend notoperiert wurde.
Bei der Zeugenvernehmung der Frau MH stellte sich heraus, dass sie die Freundin der AR ist. Der B war der Ex-Freund der AR. Im Jahr 2012 zerbrach die Beziehung, weil B sehr eifersüchtig war und Angst hatte, die AR zu verlieren. Er hat schon eine unglückliche Beziehung hinter sich gebracht und hatte eine 3-jährige Tochter. Nach der Trennung verfolgte der B die AR und bombardierte sie mit den Anrufen. Später hat er aufgehört. Als die AR eine neue Beziehung mit dem Polizisten vH anfing, ging der Terror weiter. Am 6.02. war AR bei MH, als es an der Tür klingelte. die MH machte auf. B stand vor der Tür und wollte mit AR reden. Er wirkte ruhig. die MH ließ ihn rein und ging ins Wohnzimmer, weil sie das Gefühl hatte, dass das Gespräch ruhig verlaufen wird. Kurze Zeit später hörte sie, wie die Tür zuknallte. Sie ging in die Küche und AR sagte ihr, dass der B jetzt alles verstanden haben müsste. Keine 5 Minuten später klingelte es wieder. B stand in der Tür. MH wollte ihn nicht rein lassen. Da zog er das Messer aus der Jackentasche und stürmte die Wohnung. Dabei verletzt er die MH an der Hand. Sie war so fassungslos, dass sie nichts unternommen hatte. Als sie in die Küche kam, sah sie AR auf dem Boden liegen. B saß auf ihr und hat auf die wild eingestochen. Dabei sagte er "Jetzt bringe in da zu Ende, ich töte dich Schlampe." Als AR sich nicht mehr rührte, ließ er von ihr ab und setzte sich an den Küchentisch. Dabei sagte er, dass "die Schlampe jetzt tot ist." Danach holte er das Handy raus und rief die Leitstelle.
Der Arzt der Uniklinik, der die AR operierte, teilte mit, dass die OP gut verlaufen sei und die AR außer Lebensgefahr sei. Sie hatte 12 Stiche in der Brust, Bauch, Hals und dem rechten Oberarm. Die meisten werden auch gut verheilen und keine Narben hinterlassen. Nur der Stich in den Bauch war so schwer, dass sie die Bauchhöhle öffnen mussten und diese später zunähen. Dabei wird eine ca. 10 cm große Narbe unter dem Bauchnabel verbleiben.
Die AR hat die Aussage der MH bestätigt. Weiterhin sagte sie, dass sie ihren Freund, vH, seit Tagen nicht erreichen kann. Sie habe Angst um ihn, obwohl B keine Drohungen gegen ihn geäußert hatte. die Polizei versuchte den vH vergeblich zu erreichen. Am 11.02. fanden die Spaziergänger in der Nähe der Oberkasselerbrücke ein männliche Leiche. Es handelte sich um vH. Die Autopsie hat ergeben, dass er ein Hämatom am rechten Auge hatte. Als er den Schlag abbekommen hatte, schlug sein Kopf schwer nach hinten und dabei erfolgte eine Blutung im Basisbereich des Gehirns, die zum sofortigen Hirntot führte. diese folge sei eine medizinische Rarität, da normalerweise die Halsmuskeln reflexartig versteifen und so den Kopf beim Schlag schützen. Diese Abweichung kann darauf beruhen, dass der vH eine BAK von 1,3 bis 1,5 hatte.
Der B wurde daraufhin vernommen. Er wurde belehrt über sein Schweigerecht und Recht auf einen Anwalt. Er sagte er sei Hartz 4 Empfänger und habe kein Geld für einen Anwalt. Danach sagte er, dass er nichts mit der Leiche m Rheinufer zu tun hatte. Als ihm vorgehalten wurde, dass der Fundort ihm nicht benannt wurde, hat er alle weiteren Auskünfte verweigert. Daraufhin wurde seine Wohnung mit zwei Spürhunden durchsucht. Diese fanden Leichengeruch am Kopf der Bettes und an der Jacke des B. Bei dem Verlassen der Wohnung wurden die Beamten von einem älteren Herrn angesprochen, er wollte wissen, ob es um den Polizisten handelte, der tot sei. Als sie weiter nachfragten, eilte der Mann weg. Bei der amtlichen Zeugenvernehmung wollte er zunächst nichts sagen, weil er vor dem B Angst hatte. Danach sagten die Beamten, dass er als Zeuge die Wahrheit sagen muss. Wenn er das nicht macht, macht er sich strafbar und kann sogar ins Knast gehen. Dann ist er den Verbrechern näher, als er denken kann. Daraufhin hat der Zeuge erzählt, dass er am 5.02. den Polizisten beobachtet hatte, wie dieser zum Haus des B gelaufen sei. Dabei war er wohl betrunken, da er leicht wankte. Den Polizisten kannte er, da dieser ein paar Tage zuvor in seiner Uniform nach dem B nachfragte. Der vH stand hinter einem Auto. Als der B gegen 22 Uhr kam, haben sich die Männer unterhalten. Worüber, weiss der Zeuge nicht. Es war wohl eine hitzige Diskussion. Das konnte man an der Gestik sehen. Sie schubsten sich auch gegenseitig. Danach schlug der blonde Mann (B) dem vH ins Gesicht mit der Faust. Der vH sackte zusammen. Der B schaute ich um, hebte den vH auf und schleppte ihn ins Haus. Ob der vH das Haus verließ, wusste der Zeuge nicht. Er konnte den Mann auch nur beschreiben, weil es zu dunkel war und er das Gesicht nicht sehen konnte.
Es gab dann noch ein Schreiben des Anwalts, der sich zum Pflichtverteidiger bestellte. Dabei widersprach er der Verwertung der Aussage des Zeugen, da diese unter Anwendung verbotener Vernehmungsmethoden entstand. Er widersprach auch der Verwertung der Aussage des B, da dieser auch als Mittelloser ein Recht auf Anwalt hatte. Es ist seit Jahren gängige Praxis, dass es einen Anwaltsdienst für Mittellose in Düsseldorf gibt und die Polizei weiss auch davon.
Die §§ 158, 238, 240 und 123 StGB waren nicht zu prüfen.
Bei der Zeugenvernehmung der Frau MH stellte sich heraus, dass sie die Freundin der AR ist. Der B war der Ex-Freund der AR. Im Jahr 2012 zerbrach die Beziehung, weil B sehr eifersüchtig war und Angst hatte, die AR zu verlieren. Er hat schon eine unglückliche Beziehung hinter sich gebracht und hatte eine 3-jährige Tochter. Nach der Trennung verfolgte der B die AR und bombardierte sie mit den Anrufen. Später hat er aufgehört. Als die AR eine neue Beziehung mit dem Polizisten vH anfing, ging der Terror weiter. Am 6.02. war AR bei MH, als es an der Tür klingelte. die MH machte auf. B stand vor der Tür und wollte mit AR reden. Er wirkte ruhig. die MH ließ ihn rein und ging ins Wohnzimmer, weil sie das Gefühl hatte, dass das Gespräch ruhig verlaufen wird. Kurze Zeit später hörte sie, wie die Tür zuknallte. Sie ging in die Küche und AR sagte ihr, dass der B jetzt alles verstanden haben müsste. Keine 5 Minuten später klingelte es wieder. B stand in der Tür. MH wollte ihn nicht rein lassen. Da zog er das Messer aus der Jackentasche und stürmte die Wohnung. Dabei verletzt er die MH an der Hand. Sie war so fassungslos, dass sie nichts unternommen hatte. Als sie in die Küche kam, sah sie AR auf dem Boden liegen. B saß auf ihr und hat auf die wild eingestochen. Dabei sagte er "Jetzt bringe in da zu Ende, ich töte dich Schlampe." Als AR sich nicht mehr rührte, ließ er von ihr ab und setzte sich an den Küchentisch. Dabei sagte er, dass "die Schlampe jetzt tot ist." Danach holte er das Handy raus und rief die Leitstelle.
Der Arzt der Uniklinik, der die AR operierte, teilte mit, dass die OP gut verlaufen sei und die AR außer Lebensgefahr sei. Sie hatte 12 Stiche in der Brust, Bauch, Hals und dem rechten Oberarm. Die meisten werden auch gut verheilen und keine Narben hinterlassen. Nur der Stich in den Bauch war so schwer, dass sie die Bauchhöhle öffnen mussten und diese später zunähen. Dabei wird eine ca. 10 cm große Narbe unter dem Bauchnabel verbleiben.
Die AR hat die Aussage der MH bestätigt. Weiterhin sagte sie, dass sie ihren Freund, vH, seit Tagen nicht erreichen kann. Sie habe Angst um ihn, obwohl B keine Drohungen gegen ihn geäußert hatte. die Polizei versuchte den vH vergeblich zu erreichen. Am 11.02. fanden die Spaziergänger in der Nähe der Oberkasselerbrücke ein männliche Leiche. Es handelte sich um vH. Die Autopsie hat ergeben, dass er ein Hämatom am rechten Auge hatte. Als er den Schlag abbekommen hatte, schlug sein Kopf schwer nach hinten und dabei erfolgte eine Blutung im Basisbereich des Gehirns, die zum sofortigen Hirntot führte. diese folge sei eine medizinische Rarität, da normalerweise die Halsmuskeln reflexartig versteifen und so den Kopf beim Schlag schützen. Diese Abweichung kann darauf beruhen, dass der vH eine BAK von 1,3 bis 1,5 hatte.
Der B wurde daraufhin vernommen. Er wurde belehrt über sein Schweigerecht und Recht auf einen Anwalt. Er sagte er sei Hartz 4 Empfänger und habe kein Geld für einen Anwalt. Danach sagte er, dass er nichts mit der Leiche m Rheinufer zu tun hatte. Als ihm vorgehalten wurde, dass der Fundort ihm nicht benannt wurde, hat er alle weiteren Auskünfte verweigert. Daraufhin wurde seine Wohnung mit zwei Spürhunden durchsucht. Diese fanden Leichengeruch am Kopf der Bettes und an der Jacke des B. Bei dem Verlassen der Wohnung wurden die Beamten von einem älteren Herrn angesprochen, er wollte wissen, ob es um den Polizisten handelte, der tot sei. Als sie weiter nachfragten, eilte der Mann weg. Bei der amtlichen Zeugenvernehmung wollte er zunächst nichts sagen, weil er vor dem B Angst hatte. Danach sagten die Beamten, dass er als Zeuge die Wahrheit sagen muss. Wenn er das nicht macht, macht er sich strafbar und kann sogar ins Knast gehen. Dann ist er den Verbrechern näher, als er denken kann. Daraufhin hat der Zeuge erzählt, dass er am 5.02. den Polizisten beobachtet hatte, wie dieser zum Haus des B gelaufen sei. Dabei war er wohl betrunken, da er leicht wankte. Den Polizisten kannte er, da dieser ein paar Tage zuvor in seiner Uniform nach dem B nachfragte. Der vH stand hinter einem Auto. Als der B gegen 22 Uhr kam, haben sich die Männer unterhalten. Worüber, weiss der Zeuge nicht. Es war wohl eine hitzige Diskussion. Das konnte man an der Gestik sehen. Sie schubsten sich auch gegenseitig. Danach schlug der blonde Mann (B) dem vH ins Gesicht mit der Faust. Der vH sackte zusammen. Der B schaute ich um, hebte den vH auf und schleppte ihn ins Haus. Ob der vH das Haus verließ, wusste der Zeuge nicht. Er konnte den Mann auch nur beschreiben, weil es zu dunkel war und er das Gesicht nicht sehen konnte.
Es gab dann noch ein Schreiben des Anwalts, der sich zum Pflichtverteidiger bestellte. Dabei widersprach er der Verwertung der Aussage des Zeugen, da diese unter Anwendung verbotener Vernehmungsmethoden entstand. Er widersprach auch der Verwertung der Aussage des B, da dieser auch als Mittelloser ein Recht auf Anwalt hatte. Es ist seit Jahren gängige Praxis, dass es einen Anwaltsdienst für Mittellose in Düsseldorf gibt und die Polizei weiss auch davon.
Die §§ 158, 238, 240 und 123 StGB waren nicht zu prüfen.
08.04.2013, 09:15
Die Polizei wurde zum Tatort von Zeugen J und Zeugin B gerufen. Vor Ort fanden sie eine Frauenleiche mit deutlichen Würgemalen am Hals und Tüchern im Mund. Es gab deutliche Einbruchsspuren. Die Wohnung war verwüstet. der Zeuge B gab an, er sei der Sohn der Getöteten. Als er das Haus um 3 Uhr verlassen hatte, war die Getötete noch am Leben. Er hat die Wohnungstür beim Verlassen des Hauses abgeschlossen. Die Zeugin B hat den Verdacht geäußert, der Täter könnte der Enkel der Getöteten, der MD sein. Er ist schon straffällig gewesen. Er hat auch der Oma 300 € geklaut. Sie hat ihn aber nicht angezeigt. Vor ein paar Tagen habe die B den MD vor dem Haus getroffen, obwohl er seit einem Jahr kein Kontakt mehr zu Oma hatte. Er erkundigte sich nach der Oma. Wahrheitswidrig sagte die B, die Oma sei im Krankenhaus und werde da noch ein paar Tage verweilen. Tatsächlich war die Getötete zu Hause. Sie wollte mit dem Enkel nichts mehr zu tun haben, weil er immer, wenn er kein Geld hatte, bei ihr auftauchte und nach dem Geld fragte.
Nachdem der MD von der Polizei ausfindig gemacht wurde und befragt wurde, gab er an mit der Tat nicht zu tun zu haben und am Tattag bei seinem Freund EK gewesen zu sein. Nachdem der EK von der Polizei befragt wurde, hat er angegeben, MD war nicht bei ihm. MD wurde noch mal befragt und hat den Einbruch gestanden, aber die Tötung der Oma geleugnet. Er hat angegeben, der EK hat sie getötet. Nach erneuter Befragung gab EK an, am Einbruch beteiligt gewesen zu sein, aber die Frau nicht umgebracht zu haben.
EK sagte in der Verhandlung aus, der MD habe ihn am Abend vorher angerufen und ist vorbei gekommen. Er sagte, EK kann schnell Geld verdienen. MD wolle in das Haus der Oma einbrechen, brauche aber Hilfe. Es sei eine schnelle und sichere Geschichte, da Oma im Krankenhaus sei. Der Sohn sei Schlachter und gehe sehr früh aus dem Haus. Die Beute würden sie sich 50-50 teilen. Der EK war damit einverstanden, wollte aber nur Schmiere stehen.
Kurz vor 3 Uhr sind die Angeklagten zum Haus geschlichen und haben sich hinter dem Schießstand versteckt, um abzuwarten bis der Zeuge J das Haus verlässt. Als er fort war, schlichen sie zum Haus, um nach einem offenen Fenster zu schauen. Als sie eines der Fenster drückten, kippte es nach hinten. Dabei entstand so ein Lärm, dass die Oma aufgewacht war und das Licht einschaltete. Die Angeklagten machten sich aus dem Staub und liefen zum Schießstand. Der MD hat trotzdem vorgeschlagen, in das Haus einzusteigen. Er hat vorgeschlagen zu klingeln und dann die Oma zu überwältigen, um in das Haus reinzukommen. Dazu hat er sich eine Maske und Lederhandschuhe angezogen. EK wollte immer noch nur Schmiere stehen. Er zog sich die Kapuze über den Kopf um unerkannt zu bleiben. Als der MD klingelte, stand der EK nach seinen Angaben um die Ecke und konnte nichts sehen. Er hat nur gehört, wie MD schrie "Sie hat mich erkannt!" und dann einen Lärm, als ob etwas zu Boden ging. Er kam dazu geeilt und sah, wie MD auf der Oma saß und sie würgte. Er forderte MD zwei Mal auf, die zu lassen. Als MD dies nicht tat, berührte EK ihn an der Schulter. Erst danach ließ er von der Oma los. Diese bewegte sich nicht mehr. MD sagte, der EK soll in die Küche gehen um Handtücher zu holen und die Oma knebeln. Als EK aus der Küche zurück kam, saß MD neben der Oma. Ob er sie in der Zeit gewürgt hat, wisse er nicht. EK musste bei der Oma bleiben und ihr die Handtücher in den Mund stopfen, damit sie nicht schreit. Dies tat er aber nicht. Der MD lief in der Zeit durch das Haus mit dem Rucksack des EK und suchte nach den Wertgegenständen. Der EK hatte keine Lust neben der Frau zu stehen, und ging dem MD hinterher. Der MD war aber schon fast fertig. Die Wertgegenstände brachte er in die Küche, welche sie dann in den Rucksack stopften. Dabei nahm der EK ein Geräusch wahr und sie machten sich aus dem Staub. Warum er die Handschuhe mitgebracht hatte, weiss er nicht. Die Vitalzeichen der Oma hat keiner der beiden Männer überprüft.
Der MD gab zu, den Einbruch vorgeschlagen zu haben. Die Angaben der EK zum ersten Versuch stimmten auch. Nur der EK sollte nicht Schmiere stehen, sondern direkt ins Haus mitkommen. er war auch derjenige, der vorgeschlagen hatte, die Sturmhaube und die Handschuhe mitzunehmen, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Es stimmte auch, dass der MD vorgeschlagen hatte, an der Tür zu klingeln und die Oma zu überwältigen. Der EK war für Knebeln und Bewachen der Oma zuständig. Der MD hat geklingelt, die Tür reingedrückt und Oma mit beiden Händen an dem Oberkörper gefasst. Er hat sie zu Boden gebracht, indem er ihr ein Bein stellte. Sie wehrte sich, hat aber nicht geschrien. Er habe nur die Hände auf ihrem Mund gehalten. Sie konnte ihn auch nicht erkennen, da er die Maske und neue Klamotten trug. Er konnte sie auch nicht würgen, da es alles sehr schnell ging. Der EK hat dann die Küchentücher aus der Küche gebracht. Die Männer haben die Positionen gewechselt. Der EK gab dem MD den Rucksack und blieb bei der Oma. Später kam er dazu, aber die Sachen waren schon gefunden. Das Bargeld (20 €) teilten sie direkt nach der Tat. Den Laptop verkauften sie am nächsten Tag für 170 € an einen Drogenabhängigen und teilten sich das Geld.
Die Zeugen B und J sagten nichts neues. Der Rechtsmediziner bestätigte, dass die Frau erwürgt wurde. Es gab gleichmäßige Spuren auf dem Hals. Es konnte ausgeschloßen werden, dass zwei Personen sie würgten. Grds. tritt nach 30 Sekunden der Bewusstseinsverlust und der das Ersticken nach ca. 1 Minute. Spätestens nach 5 Minuten ist ein Mensch tot. Wie lange es bei der Oma gedauert hatte, konnte er aber nicht sagen.
Die StA klagte die beiden Männer wegen §§ 244 I Nr. 3, II, 22, 23 I, 25 II sowie § 211 II (Habgier und Verdeckung einer Straftat), 25 II in Tatmehrheit an. MD wurde tateinheitlich mit Mord auch wegen §§ 249,251 angeklagt.
Beide saßen in der U-Haft.
Es war eine Entscheidung des Gerichts bzgl. MD und EK zu entwerfen. Darstellung der Kosten und der persönlichen Verhältnisse war erlassen. §§ 123, 303 und 323 c waren nicht zu prüfen.
Nachdem der MD von der Polizei ausfindig gemacht wurde und befragt wurde, gab er an mit der Tat nicht zu tun zu haben und am Tattag bei seinem Freund EK gewesen zu sein. Nachdem der EK von der Polizei befragt wurde, hat er angegeben, MD war nicht bei ihm. MD wurde noch mal befragt und hat den Einbruch gestanden, aber die Tötung der Oma geleugnet. Er hat angegeben, der EK hat sie getötet. Nach erneuter Befragung gab EK an, am Einbruch beteiligt gewesen zu sein, aber die Frau nicht umgebracht zu haben.
EK sagte in der Verhandlung aus, der MD habe ihn am Abend vorher angerufen und ist vorbei gekommen. Er sagte, EK kann schnell Geld verdienen. MD wolle in das Haus der Oma einbrechen, brauche aber Hilfe. Es sei eine schnelle und sichere Geschichte, da Oma im Krankenhaus sei. Der Sohn sei Schlachter und gehe sehr früh aus dem Haus. Die Beute würden sie sich 50-50 teilen. Der EK war damit einverstanden, wollte aber nur Schmiere stehen.
Kurz vor 3 Uhr sind die Angeklagten zum Haus geschlichen und haben sich hinter dem Schießstand versteckt, um abzuwarten bis der Zeuge J das Haus verlässt. Als er fort war, schlichen sie zum Haus, um nach einem offenen Fenster zu schauen. Als sie eines der Fenster drückten, kippte es nach hinten. Dabei entstand so ein Lärm, dass die Oma aufgewacht war und das Licht einschaltete. Die Angeklagten machten sich aus dem Staub und liefen zum Schießstand. Der MD hat trotzdem vorgeschlagen, in das Haus einzusteigen. Er hat vorgeschlagen zu klingeln und dann die Oma zu überwältigen, um in das Haus reinzukommen. Dazu hat er sich eine Maske und Lederhandschuhe angezogen. EK wollte immer noch nur Schmiere stehen. Er zog sich die Kapuze über den Kopf um unerkannt zu bleiben. Als der MD klingelte, stand der EK nach seinen Angaben um die Ecke und konnte nichts sehen. Er hat nur gehört, wie MD schrie "Sie hat mich erkannt!" und dann einen Lärm, als ob etwas zu Boden ging. Er kam dazu geeilt und sah, wie MD auf der Oma saß und sie würgte. Er forderte MD zwei Mal auf, die zu lassen. Als MD dies nicht tat, berührte EK ihn an der Schulter. Erst danach ließ er von der Oma los. Diese bewegte sich nicht mehr. MD sagte, der EK soll in die Küche gehen um Handtücher zu holen und die Oma knebeln. Als EK aus der Küche zurück kam, saß MD neben der Oma. Ob er sie in der Zeit gewürgt hat, wisse er nicht. EK musste bei der Oma bleiben und ihr die Handtücher in den Mund stopfen, damit sie nicht schreit. Dies tat er aber nicht. Der MD lief in der Zeit durch das Haus mit dem Rucksack des EK und suchte nach den Wertgegenständen. Der EK hatte keine Lust neben der Frau zu stehen, und ging dem MD hinterher. Der MD war aber schon fast fertig. Die Wertgegenstände brachte er in die Küche, welche sie dann in den Rucksack stopften. Dabei nahm der EK ein Geräusch wahr und sie machten sich aus dem Staub. Warum er die Handschuhe mitgebracht hatte, weiss er nicht. Die Vitalzeichen der Oma hat keiner der beiden Männer überprüft.
Der MD gab zu, den Einbruch vorgeschlagen zu haben. Die Angaben der EK zum ersten Versuch stimmten auch. Nur der EK sollte nicht Schmiere stehen, sondern direkt ins Haus mitkommen. er war auch derjenige, der vorgeschlagen hatte, die Sturmhaube und die Handschuhe mitzunehmen, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Es stimmte auch, dass der MD vorgeschlagen hatte, an der Tür zu klingeln und die Oma zu überwältigen. Der EK war für Knebeln und Bewachen der Oma zuständig. Der MD hat geklingelt, die Tür reingedrückt und Oma mit beiden Händen an dem Oberkörper gefasst. Er hat sie zu Boden gebracht, indem er ihr ein Bein stellte. Sie wehrte sich, hat aber nicht geschrien. Er habe nur die Hände auf ihrem Mund gehalten. Sie konnte ihn auch nicht erkennen, da er die Maske und neue Klamotten trug. Er konnte sie auch nicht würgen, da es alles sehr schnell ging. Der EK hat dann die Küchentücher aus der Küche gebracht. Die Männer haben die Positionen gewechselt. Der EK gab dem MD den Rucksack und blieb bei der Oma. Später kam er dazu, aber die Sachen waren schon gefunden. Das Bargeld (20 €) teilten sie direkt nach der Tat. Den Laptop verkauften sie am nächsten Tag für 170 € an einen Drogenabhängigen und teilten sich das Geld.
Die Zeugen B und J sagten nichts neues. Der Rechtsmediziner bestätigte, dass die Frau erwürgt wurde. Es gab gleichmäßige Spuren auf dem Hals. Es konnte ausgeschloßen werden, dass zwei Personen sie würgten. Grds. tritt nach 30 Sekunden der Bewusstseinsverlust und der das Ersticken nach ca. 1 Minute. Spätestens nach 5 Minuten ist ein Mensch tot. Wie lange es bei der Oma gedauert hatte, konnte er aber nicht sagen.
Die StA klagte die beiden Männer wegen §§ 244 I Nr. 3, II, 22, 23 I, 25 II sowie § 211 II (Habgier und Verdeckung einer Straftat), 25 II in Tatmehrheit an. MD wurde tateinheitlich mit Mord auch wegen §§ 249,251 angeklagt.
Beide saßen in der U-Haft.
Es war eine Entscheidung des Gerichts bzgl. MD und EK zu entwerfen. Darstellung der Kosten und der persönlichen Verhältnisse war erlassen. §§ 123, 303 und 323 c waren nicht zu prüfen.
08.04.2013, 09:17
die Kläger wenden sich gegen die wasserrechtliche Ordnungsverfügung. Der Beklagte ist der Bergisch-Gladbach-Kreis.
Die Kläger sind Eigentümer eines Grundstücks, welches mit seinen zwei Seiten an ein kleines Fluss grenzt. Das Grundstück ist mit einem Haus bebaut. Das Gebiet ist im B-Plan als allgemeines Wohngebiet bezeichnet. Im Jahr 2002 errichteten die Kläger an den Flussseiten einen Zaun. Die Behörde wurde darauf aufmerksam und bat sie um eine Stellungnahme. Sie wies daraufhin, dass der Zaun genehmigungspflichtig sei. Die Kläger behaupten, bei einem Gespräch im Jahr 2003 wurde ihnen signalisiert, dass der Zaun so stehen bleiben könne. Im März 2003 erhielten sie einen Anruf von der Mitarbeiterin der zuständigen Behörde, die ihnen mitteilte, dass der Zaun so stehen bleiben kann und die Angelegenheit sich erledigt habe.
Am 10.12.2012 erhielten die Kläger erneut Post vom Landrat. Er wies sie darauf hin, dass er eine Beseitigungsanordnung bzgl. der Zauns beabsichtige und diese sich dazu äußern sollen. Am 18.01.2013 wurde den Klägern eine Ordnungsverfügung zugestellt. Er wurde der Rückbau des Zauns innerhalb eines Monats nach Bestandskraft der Verfügung angeordnet und ein Zwangsgeld iHv 300 € angedroht. Als Begründung führte die Behörde aus, der Zaun sei eine genehmigungspflichtige Anlage gem. § 36 WHG iVm §§ 97 VI S. 2, 99 LWG NRW. Eine Genehmigung haben die Kläger nicht. Weiterhin ist durch den Zaun auch die Pflege des Baches erschwert sowie es besteht eine im Fall eines Hochwassers eine Abflußgefahr, wenn das Treibgut sich im Zaun verfängt. Die Kläger haben den Zaun zum Teil direkt an der Böschungsoberkante sowie in ihrer Nähe den Zaun errichten lassen. Weiterhin sind in dem B-Plan keine Umzäunungen vorgesehen. Die Behörde sei auch gem. § 14 OBG zum einschreiten berechtigt.
Am 5.02.2013 haben die Kläger die Klage beim VG Köln erhoben. Sie wandten ein, sie haben den Zaun errichtet, weil sie Angst hatten, dass ihre Kinder beim Spielen im Garten in den Fluss fallen und ertrinken könnten. Weiterhin könnten die Hunde der Spaziergänger den Fluss problemlos überqueren und so ihren eigenen Hund im Garten angreifen.
Zwar sehe der B-Plan keine Umzäunungen vor, aber dies ist gem §§ 14 iVm 23 V BauNVO zulässig und daher ist die Anlage auch genehmigungsfähig. Da die Behörde im Jahr 2003 den SV für erledigt erklärte, habe sie auch ihre Eingriffsbefugnis verwirkt. Weiterhin haben sie den Zustand seit fast 10 Jahren in Kenntnis geduldet. Sie beantragten, den Bescheid aufzuheben.
Der Beklagte erwiderte, dass er vom Anruf der Mitarbeiterin keine Kenntnis hatte. Auch im Verwaltungsvorgang sei kein Vermerk darüber. Weiterhin hat der Beklagte die EGL korrigiert. Richtige EGL sei § 100 I WHG. Die Anlage sei weiterhin genehmigungsbedürftig, aber nicht genehmigungsfähig.
Die Richterin forderte den B-Plan ein. Im Vermerk stand, dass der B-Plan tatsächlich keine Erwägungen zu Einfriedungen und zum Gewässerschutz enthielt. Der Zaun wurde hinter der festgesetzten Grenze des bebaubaren Grundstücks errichtet. Sie ordnete einen Ortstermin.
Beim Ortstermin ergab sich, dass die Kläger den Zaum am 27.02.13 entfernen ließen. Die Teile sind nur teilweise verwertbar und haben einen Wert von 2000 €. Die Errichtung hat sie vor 10 Jahren 3500 € gekostet. Sie erklären aber die Angelegenheit nicht für erledigt, da sie gegen den Beklagten wegen Schadensersatzanspruches vorgehen möchten. Sollte das Gericht die Klage wegen Erledigung trotzdem für unzulässig halten, so beantragen sie hilfsweise festzustellen, dass der Bescheid rechtswidrig gewesen ist. Die Beteiligten äußerten keine Bedenken gegen eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung durch die Berichterstatterin als Einzelrichterin.
Die Kläger sind Eigentümer eines Grundstücks, welches mit seinen zwei Seiten an ein kleines Fluss grenzt. Das Grundstück ist mit einem Haus bebaut. Das Gebiet ist im B-Plan als allgemeines Wohngebiet bezeichnet. Im Jahr 2002 errichteten die Kläger an den Flussseiten einen Zaun. Die Behörde wurde darauf aufmerksam und bat sie um eine Stellungnahme. Sie wies daraufhin, dass der Zaun genehmigungspflichtig sei. Die Kläger behaupten, bei einem Gespräch im Jahr 2003 wurde ihnen signalisiert, dass der Zaun so stehen bleiben könne. Im März 2003 erhielten sie einen Anruf von der Mitarbeiterin der zuständigen Behörde, die ihnen mitteilte, dass der Zaun so stehen bleiben kann und die Angelegenheit sich erledigt habe.
Am 10.12.2012 erhielten die Kläger erneut Post vom Landrat. Er wies sie darauf hin, dass er eine Beseitigungsanordnung bzgl. der Zauns beabsichtige und diese sich dazu äußern sollen. Am 18.01.2013 wurde den Klägern eine Ordnungsverfügung zugestellt. Er wurde der Rückbau des Zauns innerhalb eines Monats nach Bestandskraft der Verfügung angeordnet und ein Zwangsgeld iHv 300 € angedroht. Als Begründung führte die Behörde aus, der Zaun sei eine genehmigungspflichtige Anlage gem. § 36 WHG iVm §§ 97 VI S. 2, 99 LWG NRW. Eine Genehmigung haben die Kläger nicht. Weiterhin ist durch den Zaun auch die Pflege des Baches erschwert sowie es besteht eine im Fall eines Hochwassers eine Abflußgefahr, wenn das Treibgut sich im Zaun verfängt. Die Kläger haben den Zaun zum Teil direkt an der Böschungsoberkante sowie in ihrer Nähe den Zaun errichten lassen. Weiterhin sind in dem B-Plan keine Umzäunungen vorgesehen. Die Behörde sei auch gem. § 14 OBG zum einschreiten berechtigt.
Am 5.02.2013 haben die Kläger die Klage beim VG Köln erhoben. Sie wandten ein, sie haben den Zaun errichtet, weil sie Angst hatten, dass ihre Kinder beim Spielen im Garten in den Fluss fallen und ertrinken könnten. Weiterhin könnten die Hunde der Spaziergänger den Fluss problemlos überqueren und so ihren eigenen Hund im Garten angreifen.
Zwar sehe der B-Plan keine Umzäunungen vor, aber dies ist gem §§ 14 iVm 23 V BauNVO zulässig und daher ist die Anlage auch genehmigungsfähig. Da die Behörde im Jahr 2003 den SV für erledigt erklärte, habe sie auch ihre Eingriffsbefugnis verwirkt. Weiterhin haben sie den Zustand seit fast 10 Jahren in Kenntnis geduldet. Sie beantragten, den Bescheid aufzuheben.
Der Beklagte erwiderte, dass er vom Anruf der Mitarbeiterin keine Kenntnis hatte. Auch im Verwaltungsvorgang sei kein Vermerk darüber. Weiterhin hat der Beklagte die EGL korrigiert. Richtige EGL sei § 100 I WHG. Die Anlage sei weiterhin genehmigungsbedürftig, aber nicht genehmigungsfähig.
Die Richterin forderte den B-Plan ein. Im Vermerk stand, dass der B-Plan tatsächlich keine Erwägungen zu Einfriedungen und zum Gewässerschutz enthielt. Der Zaun wurde hinter der festgesetzten Grenze des bebaubaren Grundstücks errichtet. Sie ordnete einen Ortstermin.
Beim Ortstermin ergab sich, dass die Kläger den Zaum am 27.02.13 entfernen ließen. Die Teile sind nur teilweise verwertbar und haben einen Wert von 2000 €. Die Errichtung hat sie vor 10 Jahren 3500 € gekostet. Sie erklären aber die Angelegenheit nicht für erledigt, da sie gegen den Beklagten wegen Schadensersatzanspruches vorgehen möchten. Sollte das Gericht die Klage wegen Erledigung trotzdem für unzulässig halten, so beantragen sie hilfsweise festzustellen, dass der Bescheid rechtswidrig gewesen ist. Die Beteiligten äußerten keine Bedenken gegen eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung durch die Berichterstatterin als Einzelrichterin.
08.04.2013, 09:17
Der Mandant ist Sportschütze und seit 2001 Mitglied im Schützensportverein in Düsseldorf. Im Jahr 2005 erteilte ihm die zuständige Behörde, das PP Düsseldorf, die Waffenerlaubnis und trug in die Waffenbesitzkarte drei verschiedene Waffentypen ein. Die Erlaubnis wurde danach mehrmals ohne Beanstandungen erneuert.
Der Mandant ist seit dem Jahr 2007 Mitglied des Vorstandes der P-Partei und für den Marketingvertrieb zuständig. Die P-Partei hat einen rechtsextremistischen Inhalt. Im Jahr 2011 scheiterte jedoch das Verbot der Partei vor dem BVerfG. Da der Mandant für den Produktenvertrieb zuständig ist, bring er auch eigene Ideen mit, welche dann auch verwirklicht werden. Er hat T-Shirts entworfen, auf denen volksverhetzende und menschenverachtende Slogans abgedruckt sind.
Im Juli 2012 teilte ihm die Behörde mit, sie wolle ihm die Erlaubnis entziehen und bat um Stellungnahme. Am 30.08.12 erging gegen den Mandanten ein Bescheid. Danach wurde ihm die Erlaubnis entzogen, er musste die Waffenbesitzkarte und die Waffen abgeben und darüber Nachweis führen. Die Behörde stützte sich auf §§ 45 II iVm 4, 5 WaffG und teilte ihm mit, dass er wegen seiner Tätigkeit in der Partei die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt (§ 5 II Nr. 3b WaffG). Eine RMB war nicht vorhanden. Der Mandant wusste auch nicht mehr, wann er den Bescheid zugestellt bekommen habe.
Der Mandant folgte der Anordnung und sendete die Waffenbesitzkarte an das PP D'dorf sowie gab seine Waffen dem Schützenbruder Herrn B. Da er aus gesundheitlichen Gründen sich nicht um die Angelegenheit kümmern konnte, bat er Herrn B für ihn die Klage zu erheben. Dabei sollte seine Anschrift aus den Gründen der Tätigkeit nicht angegeben werden. Am 4.10.12 erhob der Herr B im Namen und mit Vollmacht des Mandanten eine Klage beim VG Düsseldorf. Er beantragte, den Bescheid aufzuheben. In der Begründetheit vertrat Herr B die Meinung, dass bei eine parteibezogenen Tätigkeit § 5 II Nr. 2B WaffG spezieller ist und daher dem § 5 II Nr. 3b WaffG vorgeht. Danach passierte zunächst nichts mehr. Am 19.02.13, dem Mandanten am 20.02.13 zugestellten Bescheid, holte die Behörde die RMB nach sowie stützte sich darauf, dass der Mandant auch keine Bedürfnis iSv § 8 WaffG mehr hat, da er seit einem Jahr kein Sport mehr betreibt. Das Gericht forderte Herrn B auf, die Klage nicht mehr zu verfolgen, da er gem. § 67 II VwGO nicht vertretungsbefugt ist. Anderenfalls ergeht ein zurückweisender Bescheid. Weiterhin soll die Anschrift des Klägers bis zum 19.04.13 dem Gericht mitgeteilt werden. Und der Anwendungsbereich des § 5 II WaffG könnte durchaus anders verstanden werden.
Der Mandant möchte die Erfolgsaussichten der Klage überprüft haben. Seine Anschrift soll nur dann dem Gericht mitgeteilt werden, wenn er ohne die Mitteilung den Prozess verlieren würde. Weiterhin möchte er auch die Waffenbesitzkarte zurück haben, da er die Waffen von Herrn B sich zurück holen kann. Der Mandant ist wieder vollständig gesund und möchte an den Turnieren teilnehmen und kann dies gerade aus den o.g. Umständen nicht.
Dem SV war die Begründung des Gesetzesentwurfs zum § 5 II WaffG beigefügt. Weiterhin berief sich auch die Behörde auf die "Ausnahme-Entscheidung" des BVerwG, welche besagte, dass ausnahmsweise die Erlaubnis nach dem Waffengesetz erteilt werden darf, wenn aus dem Vorleben der betroffenen Person ergibt, dass sie mit den Waffen ordnungsgemäß umgeht und darauf vertraut werden darf, dass dies auch in der Zukunft so passiert.
Die weiteren Voraussetzungen des § 4 WaffG waren nach dem Bearbeitervermerk erfüllt. Die Verwaltungsakten lagen auch dem Gericht mittlerweile vor.
Der Mandant ist seit dem Jahr 2007 Mitglied des Vorstandes der P-Partei und für den Marketingvertrieb zuständig. Die P-Partei hat einen rechtsextremistischen Inhalt. Im Jahr 2011 scheiterte jedoch das Verbot der Partei vor dem BVerfG. Da der Mandant für den Produktenvertrieb zuständig ist, bring er auch eigene Ideen mit, welche dann auch verwirklicht werden. Er hat T-Shirts entworfen, auf denen volksverhetzende und menschenverachtende Slogans abgedruckt sind.
Im Juli 2012 teilte ihm die Behörde mit, sie wolle ihm die Erlaubnis entziehen und bat um Stellungnahme. Am 30.08.12 erging gegen den Mandanten ein Bescheid. Danach wurde ihm die Erlaubnis entzogen, er musste die Waffenbesitzkarte und die Waffen abgeben und darüber Nachweis führen. Die Behörde stützte sich auf §§ 45 II iVm 4, 5 WaffG und teilte ihm mit, dass er wegen seiner Tätigkeit in der Partei die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt (§ 5 II Nr. 3b WaffG). Eine RMB war nicht vorhanden. Der Mandant wusste auch nicht mehr, wann er den Bescheid zugestellt bekommen habe.
Der Mandant folgte der Anordnung und sendete die Waffenbesitzkarte an das PP D'dorf sowie gab seine Waffen dem Schützenbruder Herrn B. Da er aus gesundheitlichen Gründen sich nicht um die Angelegenheit kümmern konnte, bat er Herrn B für ihn die Klage zu erheben. Dabei sollte seine Anschrift aus den Gründen der Tätigkeit nicht angegeben werden. Am 4.10.12 erhob der Herr B im Namen und mit Vollmacht des Mandanten eine Klage beim VG Düsseldorf. Er beantragte, den Bescheid aufzuheben. In der Begründetheit vertrat Herr B die Meinung, dass bei eine parteibezogenen Tätigkeit § 5 II Nr. 2B WaffG spezieller ist und daher dem § 5 II Nr. 3b WaffG vorgeht. Danach passierte zunächst nichts mehr. Am 19.02.13, dem Mandanten am 20.02.13 zugestellten Bescheid, holte die Behörde die RMB nach sowie stützte sich darauf, dass der Mandant auch keine Bedürfnis iSv § 8 WaffG mehr hat, da er seit einem Jahr kein Sport mehr betreibt. Das Gericht forderte Herrn B auf, die Klage nicht mehr zu verfolgen, da er gem. § 67 II VwGO nicht vertretungsbefugt ist. Anderenfalls ergeht ein zurückweisender Bescheid. Weiterhin soll die Anschrift des Klägers bis zum 19.04.13 dem Gericht mitgeteilt werden. Und der Anwendungsbereich des § 5 II WaffG könnte durchaus anders verstanden werden.
Der Mandant möchte die Erfolgsaussichten der Klage überprüft haben. Seine Anschrift soll nur dann dem Gericht mitgeteilt werden, wenn er ohne die Mitteilung den Prozess verlieren würde. Weiterhin möchte er auch die Waffenbesitzkarte zurück haben, da er die Waffen von Herrn B sich zurück holen kann. Der Mandant ist wieder vollständig gesund und möchte an den Turnieren teilnehmen und kann dies gerade aus den o.g. Umständen nicht.
Dem SV war die Begründung des Gesetzesentwurfs zum § 5 II WaffG beigefügt. Weiterhin berief sich auch die Behörde auf die "Ausnahme-Entscheidung" des BVerwG, welche besagte, dass ausnahmsweise die Erlaubnis nach dem Waffengesetz erteilt werden darf, wenn aus dem Vorleben der betroffenen Person ergibt, dass sie mit den Waffen ordnungsgemäß umgeht und darauf vertraut werden darf, dass dies auch in der Zukunft so passiert.
Die weiteren Voraussetzungen des § 4 WaffG waren nach dem Bearbeitervermerk erfüllt. Die Verwaltungsakten lagen auch dem Gericht mittlerweile vor.
08.04.2013, 15:55
Danke Aleksandra für die Zusammenfassungen der Klausuren :) Ich bin im Mai dran und werde dann auch berichten!