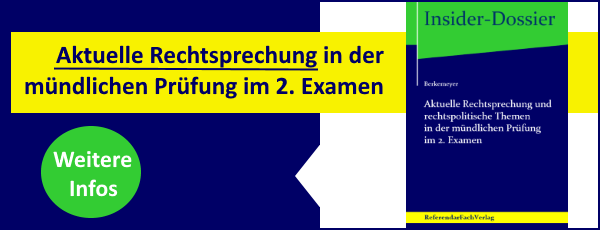25.09.2024, 20:22
(25.09.2024, 09:52)g3rn3gr0s schrieb: Als ob die schriftliche Prüfung objektiver wäre.Ich habe mittlerweile tausende Klausuren korrigiert. Das System ist mE sehr gut darin, schlechte Juristen auszusortieren und sehr schlecht darin, gute Juristen fair und folgerichtig zu bewerten. Das deckt sich im Übrigen mit der IQ-Forschung, wonach wenig Varianz zwischen den einzigen Fähigkeiten bei niedrigen IQs herrscht, aber eine hohe Varianz bei hohen IQs. Salopp: Schlechte Kandidaten schriftlicher Prüfungen sind zumeist hinsichtlich aller Aspekte schlecht, gute Kandidaten sind auf teilweise völlig unterschiedliche Weisen gut.
26.09.2024, 09:15
Ich kann deinen Frust absolut nachvollziehen. Ich hab mich nach 2 Wochen immer noch nicht erholt. Hast du Widerspruch eingelegt?
26.09.2024, 22:10
Es ist immer schwierig etwas zu Prüfungen zu sagen, bei denen man nicht dabei war.
Generell würde ich sagen: Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, dass auch mündlich geprüft wird. Das ist insofern nachvollziehbar, als man damit ein übergeordnetes Verständnis prüfen will, mündliche Ausdrucksfähigkeit und auch eine gewisse Fähigkeit, sich als Person zu präsentieren - Fähigkeiten, die in dem Beruf eine Rolle spielen.
Mit dieser Entscheidung nimmt der Gesetzgeber gewisse strukturelle Nachteile gegenüber einer rein schriftlichen Prüfung in Kauf. Zunächst ist es nicht anonym, und es besteht immer die Gefahr, dass Äußerlichkeiten und die Fähigkeit, sich gut zu verkaufen, (übermäßig) in die Bewertung hineinspielen. Dann das Problem, dass der flüchtige Eindruck nicht festgehalten wird, was eine Nachprüfung der Bewertung erschwert. Und schließlich die Ungleichbehandlung dadurch, dass nicht alle Kandidaten, ja nicht einmal alle innerhalb einer Gruppe, die gleichen Fälle und Fragen erhalten.
Andererseits gibt es auch strukturelle Vorteile: während ich im Schriftlichen wegen eines Fehlers die komplette Klausur an der Aufgabe vorbeischreiben kann, werde ich im Mündlichen schnell wieder aufs Gleis gesetzt, wenn ich z.B. die Frage falsch verstanden habe. Und während im Schriftlichen meist nur zwei Prüfer, der zweite oft nur zurückgenommen, prüfen, sitzt man hier einer Kommission gegenüber, die im Normalfall intensiv diskutiert, wie die Leistung zu bewerten ist.
Als Prüfer muss ich sagen, dass ich sehr gerne mündlich prüfe. Es ist schon schön, am Ende nochmal mit über die Gesamtleistung drüberschauen zu können und die Endnote mit beeinflussen zu dürfen. Erhebliche Sprünge nach oben habe ich selten erlebt. Auch nach unten nicht. Möglich müssen sie aber sein: wie soll man eine Prüfung bewerten, in der ausschließlich Falsches oder auf Fragen gar nichts gesagt wird? Da kann man ja nicht wegen guter Vornoten 10 Punkte geben.
Von Willkür kann ich weder aus meiner aktiven (was nicht viel heißt) noch passiven Rolle her berichten. Dass man manche Leistung auch anders bewerten könnte, ist eine andere Sache, es ist und bleibt eben eine Bewertung.
Generell würde ich sagen: Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, dass auch mündlich geprüft wird. Das ist insofern nachvollziehbar, als man damit ein übergeordnetes Verständnis prüfen will, mündliche Ausdrucksfähigkeit und auch eine gewisse Fähigkeit, sich als Person zu präsentieren - Fähigkeiten, die in dem Beruf eine Rolle spielen.
Mit dieser Entscheidung nimmt der Gesetzgeber gewisse strukturelle Nachteile gegenüber einer rein schriftlichen Prüfung in Kauf. Zunächst ist es nicht anonym, und es besteht immer die Gefahr, dass Äußerlichkeiten und die Fähigkeit, sich gut zu verkaufen, (übermäßig) in die Bewertung hineinspielen. Dann das Problem, dass der flüchtige Eindruck nicht festgehalten wird, was eine Nachprüfung der Bewertung erschwert. Und schließlich die Ungleichbehandlung dadurch, dass nicht alle Kandidaten, ja nicht einmal alle innerhalb einer Gruppe, die gleichen Fälle und Fragen erhalten.
Andererseits gibt es auch strukturelle Vorteile: während ich im Schriftlichen wegen eines Fehlers die komplette Klausur an der Aufgabe vorbeischreiben kann, werde ich im Mündlichen schnell wieder aufs Gleis gesetzt, wenn ich z.B. die Frage falsch verstanden habe. Und während im Schriftlichen meist nur zwei Prüfer, der zweite oft nur zurückgenommen, prüfen, sitzt man hier einer Kommission gegenüber, die im Normalfall intensiv diskutiert, wie die Leistung zu bewerten ist.
Als Prüfer muss ich sagen, dass ich sehr gerne mündlich prüfe. Es ist schon schön, am Ende nochmal mit über die Gesamtleistung drüberschauen zu können und die Endnote mit beeinflussen zu dürfen. Erhebliche Sprünge nach oben habe ich selten erlebt. Auch nach unten nicht. Möglich müssen sie aber sein: wie soll man eine Prüfung bewerten, in der ausschließlich Falsches oder auf Fragen gar nichts gesagt wird? Da kann man ja nicht wegen guter Vornoten 10 Punkte geben.
Von Willkür kann ich weder aus meiner aktiven (was nicht viel heißt) noch passiven Rolle her berichten. Dass man manche Leistung auch anders bewerten könnte, ist eine andere Sache, es ist und bleibt eben eine Bewertung.
30.09.2024, 12:11
(25.09.2024, 11:25)NewNRW24 schrieb: Finde es ist nicht nur ein Problem der mündlichen Prüfung.Finde es spannend, dass diese Studie immer wieder hervorgekramt und als Beweis für die absolute Willkür dargestellt wird. Hierzu vielleicht ein paar Gedanken:
Siehe Klausuren,,Studie" in Bayern an der LMU. Dieselben Klausuren haben eine Notendifferenz von 6,47 Punkten
(https://www.lto.de/karriere/im-job/stori...men-examen).
Meiner Meinung nach, gibt es ein paar wenige Überflieger, die über der Willkür stehen. Der Rest ist dem ausgesetzt.
Egal ob in der schriftlichen Prüfung oder in der mündlichen Prüfung.
Überall spielt Glück und Pech mit rein.
- Hier wurden Drittsemester-Klausuren von Unikorrektoren betrachtet. Im Examen gibt es immer Zweitkorrektoren (welche selbst bei Nicht-Blindkorrekturen krasse Ausreißer tendenziell korrigieren dürften). Außerdem sind Professoren und Richter vermutlich tendenziell besser im Korrigieren als Unikorrektoren. Das heißt, die Abweichung im Examen dürfte tendenziell weniger groß sein.
- Hier haben immer sechzehn Leute eine Klausur korrigiert. Die Abweichung von 6,47 Punkten ist zwar nach wie vor groß, aber das sind schon auch sehr viele Korrektoren.
- Man schreibt ja in NRW zumindest sechs Klausuren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sechsmal auf den am schlechtesten bewertenden der sechzehn Korrektoren der Studie trifft, dürfte doch äußerst gering sein.
Ich denke, dass es auch bei der mündlichen Prüfung erhebliche Abweichungen geben dürfte, je nachdem, welche Prüfer man hat. Das wäre, denke ich, genau wie bei den schriftlichen Prüfungen kein Problem, wenn die mündliche Prüfung nicht so viel zählen würde. Denn dann würde sich das auch wieder herausmitteln. Zählt aber diese einzelne Prüfungsleistung, wie in NRW, 40 %, ist das ein Problem. Dass dies als ungerecht empfunden wird, zeigt sich auch daran, dass die Prüfer versuchen, dem entgegenzuwirken, indem sie die Mündliche Prüfung vornotenorientiert bewerten. Daher denke ich, das Problem ist nicht die mündliche Prüfung selbst, sondern ihre Gewichtung. Würde diese einfach 10 % oder von mir aus maximal 15 % zählen, wäre das alles weitgehend in Ordnung.
30.09.2024, 16:46
Ich bin aufgrund überwiegend positiver Erfahrungen zwar tendenziell ein Freund mündlicher Prüfungen. In ihrem Rahmen lassen sich nämlich Zusammenhänge prüfen, die sich schlecht in die sehr spezifischen juristischen Klausuren integrieren lassen (etwa Grundbegriffe der Methodenlehre oder ein gewisses - kein übertriebenes! - rechtshistorisches Grundlagenwissen).
Und doch ist die ganze Veranstaltung und ihr zu großer Impact bei Lichte betrachtet der helle Wahnsinn. Es gibt für mich zwei Aspekte, die das auf den Punkt bringen:
Es gilt kein klarer Maßstab. Ich habe einmal Widerspruch gegen ein Prüfungsgespräch eingelegt. Man meint ja, es sei eine Selbstverständlichkeit, dass der Bewertungsmaßstab ein relativer ist, sprich: der eine Kandidat wird immer auch mit Blick auf die Leistung der anderen bewertet. Schon leise psychologische Vermutungen dürften bei jedem in die Richtung gehen, dass sich Prüfer von einem solchen vergleichenden Blick nicht freimachen können. Bei der Klausurkorrektur ist dies nicht anders, ja wohl noch stärker ausgeprägt. Äußerungen in diese Richtung ("es kommt darauf an, wie gut die anderen im Stapel sind") dürften viele auf diesem langen Ausbildungsweg von Korrektoren in den Examina gehört haben. Was der Widerspruch im Ergebnis genützt hat, könnt ihr euch denken. Für mich unfassbar war der abstrakte Teil der Begründung der Kollegen im Prüfungsamt: Es gelte nach der Rspr. des BVerwG ein streng "allgemein-objektiver Bewertungsmaßstab". Ein Vergleich der Leistungen untereinander finde sozusagen in no way, shape or form statt. Tatsächlich sind dies hergebrachte Grundsätze des Prüfungsrechts. Wer die Realitäten kennt, wird das für reine Fiktion halten. Die Konfrontation mit diesem systemischen Irrsinn hat es mir am Ende leichter gemacht, das Ergebnis zu akzeptieren - weil ich das alles kaum mehr Ernst nehmen kann (also so wirklich, nicht nur sprichwörtlich).
Für mich unfassbar war der abstrakte Teil der Begründung der Kollegen im Prüfungsamt: Es gelte nach der Rspr. des BVerwG ein streng "allgemein-objektiver Bewertungsmaßstab". Ein Vergleich der Leistungen untereinander finde sozusagen in no way, shape or form statt. Tatsächlich sind dies hergebrachte Grundsätze des Prüfungsrechts. Wer die Realitäten kennt, wird das für reine Fiktion halten. Die Konfrontation mit diesem systemischen Irrsinn hat es mir am Ende leichter gemacht, das Ergebnis zu akzeptieren - weil ich das alles kaum mehr Ernst nehmen kann (also so wirklich, nicht nur sprichwörtlich).
Zweitens beschäftigt mich ein einfacher Zusammenhang: Weicht die Bewertung des Prüfungsgesprächs bei Verbesserern erheblich von der früheren mündlichen Note ab, ist das ein kaum zu verkraftender Widerspruch. Klar, wir sagen uns zur eigenen Besänftigung (oder Motivation) alle, es handele sich nur um eine Momentaufnahme. Es gibt Konstellationen von sehr bescheidener Vornote im Erstversuch und extrem netten Kommissionen, die durch die Bank 16 Punkte und mehr verteilen (habe solche Ausreißer mehrfach in Protokollen gesichtet). Läuft es bei der Verbesserung dann schriftlich wiederum erheblich besser, ist es irgendwie ein schlechter Witz, wenn nunmehr das frühere Ergebnis nicht mehr ansatzweise erreicht wird. So wird es ja meistens sein (z.B. Vornote 9 Punkte, mündlich im Schnitt 11 Punkte). Schon klar, alles nur eine Momentaufnahme, wird es sicherlich auch in den sakrosankten Grundsätzen des Prüfungsrechts irgendwo beiläufig heißen. Ist aber schon absurd, wenn unser fiktiver Kandidat erst schriftlich beweist, dass das Gesamtergebnis des Erstversuchs die Fähigkeiten spiegelt, nur um dann in einer zweiten Mündlichen bescheinigt zu bekommen, dass das juristische Können punktgenau bei (im Beispiel) 11 Punkten liegt. Eine Differenz von 5 Punkten und zwei Notenstufen!
Und doch ist die ganze Veranstaltung und ihr zu großer Impact bei Lichte betrachtet der helle Wahnsinn. Es gibt für mich zwei Aspekte, die das auf den Punkt bringen:
Es gilt kein klarer Maßstab. Ich habe einmal Widerspruch gegen ein Prüfungsgespräch eingelegt. Man meint ja, es sei eine Selbstverständlichkeit, dass der Bewertungsmaßstab ein relativer ist, sprich: der eine Kandidat wird immer auch mit Blick auf die Leistung der anderen bewertet. Schon leise psychologische Vermutungen dürften bei jedem in die Richtung gehen, dass sich Prüfer von einem solchen vergleichenden Blick nicht freimachen können. Bei der Klausurkorrektur ist dies nicht anders, ja wohl noch stärker ausgeprägt. Äußerungen in diese Richtung ("es kommt darauf an, wie gut die anderen im Stapel sind") dürften viele auf diesem langen Ausbildungsweg von Korrektoren in den Examina gehört haben. Was der Widerspruch im Ergebnis genützt hat, könnt ihr euch denken.
 Für mich unfassbar war der abstrakte Teil der Begründung der Kollegen im Prüfungsamt: Es gelte nach der Rspr. des BVerwG ein streng "allgemein-objektiver Bewertungsmaßstab". Ein Vergleich der Leistungen untereinander finde sozusagen in no way, shape or form statt. Tatsächlich sind dies hergebrachte Grundsätze des Prüfungsrechts. Wer die Realitäten kennt, wird das für reine Fiktion halten. Die Konfrontation mit diesem systemischen Irrsinn hat es mir am Ende leichter gemacht, das Ergebnis zu akzeptieren - weil ich das alles kaum mehr Ernst nehmen kann (also so wirklich, nicht nur sprichwörtlich).
Für mich unfassbar war der abstrakte Teil der Begründung der Kollegen im Prüfungsamt: Es gelte nach der Rspr. des BVerwG ein streng "allgemein-objektiver Bewertungsmaßstab". Ein Vergleich der Leistungen untereinander finde sozusagen in no way, shape or form statt. Tatsächlich sind dies hergebrachte Grundsätze des Prüfungsrechts. Wer die Realitäten kennt, wird das für reine Fiktion halten. Die Konfrontation mit diesem systemischen Irrsinn hat es mir am Ende leichter gemacht, das Ergebnis zu akzeptieren - weil ich das alles kaum mehr Ernst nehmen kann (also so wirklich, nicht nur sprichwörtlich).Zweitens beschäftigt mich ein einfacher Zusammenhang: Weicht die Bewertung des Prüfungsgesprächs bei Verbesserern erheblich von der früheren mündlichen Note ab, ist das ein kaum zu verkraftender Widerspruch. Klar, wir sagen uns zur eigenen Besänftigung (oder Motivation) alle, es handele sich nur um eine Momentaufnahme. Es gibt Konstellationen von sehr bescheidener Vornote im Erstversuch und extrem netten Kommissionen, die durch die Bank 16 Punkte und mehr verteilen (habe solche Ausreißer mehrfach in Protokollen gesichtet). Läuft es bei der Verbesserung dann schriftlich wiederum erheblich besser, ist es irgendwie ein schlechter Witz, wenn nunmehr das frühere Ergebnis nicht mehr ansatzweise erreicht wird. So wird es ja meistens sein (z.B. Vornote 9 Punkte, mündlich im Schnitt 11 Punkte). Schon klar, alles nur eine Momentaufnahme, wird es sicherlich auch in den sakrosankten Grundsätzen des Prüfungsrechts irgendwo beiläufig heißen. Ist aber schon absurd, wenn unser fiktiver Kandidat erst schriftlich beweist, dass das Gesamtergebnis des Erstversuchs die Fähigkeiten spiegelt, nur um dann in einer zweiten Mündlichen bescheinigt zu bekommen, dass das juristische Können punktgenau bei (im Beispiel) 11 Punkten liegt. Eine Differenz von 5 Punkten und zwei Notenstufen!
30.09.2024, 23:11
Zu 1: Hier muss man zwischen dem rechtlich vorgegebenen Maßstab und den faktischen Einflüssen unterscheiden, die ihrerseits gerade nicht geleugnet, sondern wiederum Begründung für prüfungsrechtliche Rechtsprechung sind:
In der Tat ist der Maßstab objektiv - etwas vereinfacht der Referendar im Ersten Examen, das ja Eingangsprüfung in den Vorbereitungsdienst ist, und im Zweiten die Anforderungen an das Statusamt R1 (da die Befähigung zum Richteramt geprüft wird). Wer nicht kann, was ein jeder Amts- oder Landrichter zwingend können muss, bekommt keine 4 Punkte, selbst wenn die anderen auf dem Stapel noch schlechter sind. Das ist die Rechtslage.
Dass die Prüfer sich dabei, was man zwingend können muss, unter anderem auch davon beeinflussen lassen, was die Übrigen leisten (aber natürlich auch davon, was man selbst weiß und für wichtig hält, vermutlich früher in seiner eigenen Prüfung wusste usw.), ist eine faktische Sache, keine rechtliche. Man kann und sollte das reflektieren, kann es aber nicht völlig ausschließen (im Extremfall kommt es sogar zu einer Überkompensation - ich kenne einen genialen Juristen, der gleichwohl voller Verständnis für noch die krassesten Fehler von Prüflingen ist).
Gerade weil sich dieser Einfluss kaum ausschließen lässt, werden daran rechtliche Folgen geknüpft. Beispielsweise dass normalerweise nicht das VG bei erfolgreicher Anfechtung die Note neu festsetzt, sondern die Prüfer. Denn das VG kann diese Faktoren nicht berücksichtigen, sodass die Chancengleichheit beeinträchtigt wäre.
Also nochmal: der rechtliche Maßstab ist objektiv, aber es gibt subjektive Einflüsse, und das ist gerade rechtlich anerkannt.
In der Tat ist der Maßstab objektiv - etwas vereinfacht der Referendar im Ersten Examen, das ja Eingangsprüfung in den Vorbereitungsdienst ist, und im Zweiten die Anforderungen an das Statusamt R1 (da die Befähigung zum Richteramt geprüft wird). Wer nicht kann, was ein jeder Amts- oder Landrichter zwingend können muss, bekommt keine 4 Punkte, selbst wenn die anderen auf dem Stapel noch schlechter sind. Das ist die Rechtslage.
Dass die Prüfer sich dabei, was man zwingend können muss, unter anderem auch davon beeinflussen lassen, was die Übrigen leisten (aber natürlich auch davon, was man selbst weiß und für wichtig hält, vermutlich früher in seiner eigenen Prüfung wusste usw.), ist eine faktische Sache, keine rechtliche. Man kann und sollte das reflektieren, kann es aber nicht völlig ausschließen (im Extremfall kommt es sogar zu einer Überkompensation - ich kenne einen genialen Juristen, der gleichwohl voller Verständnis für noch die krassesten Fehler von Prüflingen ist).
Gerade weil sich dieser Einfluss kaum ausschließen lässt, werden daran rechtliche Folgen geknüpft. Beispielsweise dass normalerweise nicht das VG bei erfolgreicher Anfechtung die Note neu festsetzt, sondern die Prüfer. Denn das VG kann diese Faktoren nicht berücksichtigen, sodass die Chancengleichheit beeinträchtigt wäre.
Also nochmal: der rechtliche Maßstab ist objektiv, aber es gibt subjektive Einflüsse, und das ist gerade rechtlich anerkannt.