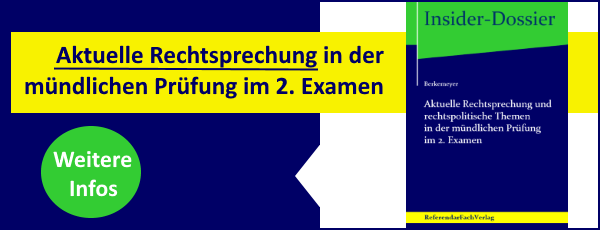03.06.2013, 10:26
Für alle, die sich über die Klausuren austauschen möchten, die im November geschrieben werden:
04.11. - Z1
05.11. - Z2
07.11. - Z3
08.11. - Z4
11.11. - S1
12.11. - S2
14.11. - V1
15.11. - V2
04.11. - Z1
05.11. - Z2
07.11. - Z3
08.11. - Z4
11.11. - S1
12.11. - S2
14.11. - V1
15.11. - V2
02.12.2013, 23:30
Z 1
Ausgangskonstellation:
Klage vorm Landgericht. 1 Kläger, 2 Beklagte. Kläger ist Privatmann, B 1 ist Privatmann und B 2 ist Inhaber eines Gebrauchtwagenhandels. Prozessuale Nebenentscheidungen waren erlassen.
Kläger begehrt Schadensersatz nach Autokauf (im Jahr 2011) in Höhe von 5.000 Euro + Verzugszinsen sowie die Feststellung, dass die Verpflichtung nach dem Antrag zu 1) auf einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung beruht (Wert nach Streitwertbeschluss: 500 €). Die Beklagten beantragen Klageabweisung. Sie rechnen hilfsweise mit einer Forderung aus einem Autounfall (der Kläger ist - unstreitig - am Morgen des Kaufs beim Einparken in das ordnungsgemäß parkende Auto des Beklagten zu 2) reingedonnert, weil seine Bremsen versagt haben) in Höhe von 1,700 € auf. Der Beklagte zu 2) macht den Anspruch (der der Höhe nach unbestritten ist; der Kläger meint nur, er habe den Unfall nicht zu verschulden und er sei auch unabwendbar gewesen) ferner im Wege der Hilfswiderklage geltend.
Der Beklagte zu 2) hat den Kaufvertrag (Kaufpreis 9.000 €; Wagen war vom B 1 via Internet inseriert; Dort fand sich die Angabe "- gut gepflegt und -Bagatellschaden, ordnungsgemäß repariert) ausdrücklich im Namen des B 1 geschlossen und auch mit "i.V." den Vertrag unterschrieben; dieser hat ihm dafür eine Provision gezahlt.
Der Kläger verkauft den Wagen später (auch 2011) an einen Dritten zu 4.000 Euro weiter (--> Klageforderung = 9.000 - 4.000), nachdem er ihn erst für 8.500 Euro verkaufen wollte. Der Dritte, der bei einer Werkstatt arbeitet, will aber festgestellt haben, dass der Wagen erhebliche Vorschäden aufweist. Hierzu wird Beweis angeboten (Zeuge, Sachverständigengutachten); Beweis wird aber in der anschließenden Beweisaufnahme nicht erhoben. Der Wert des Wagen lag - unbestritten - zwischen 3.500 und 4.500 Euro.
Im Kfz-Brief ist ein Vorhalter eingetragen.
Zur Klage:
Der Kläger macht geltend, dass man ihn über die Vorschäden getäuscht habe; man habe ihn darüber aufklären müssen (insb. da er ausdrücklich gefragt hatte, ob das die einzigen Schäden seien); auch habe man ihn über die Anzahl der Vorbesitzer aufklären müssen (dass die abweichend vom Kfz-Brief war, ging aber m.E. aus dem SV nicht hervor). Ferner habe der B2 wahrheitswidrig beim Verkauf gesagt, dass der B1 den Wagen von einem Arbeitskollegen gekauft habe; in Wirklichkeit - das wird nachher unstreitig - wurde er aber auf einem Automarkt von einem unbekannten Händler gekauft. Ob der für den eingetragenen Ersthalter gehandelt hat, bleibt unaufgeklärt. In Kenntnis all dessen hätte er den KV nicht abgeschlossen. Er meint ferner, der Aufrechnung stünde ein Aufrechnungsverbot entgegen (§ 393 BGB?) und die Aufrechnung wirke ja eh nur für den B2 (sein Auto wurde beschädigt).
Die Beklagten bestreiten die Mängel. Sie hätten aber jedenfalls keine Kenntnis gehabt und daher auch keine Aufklärungspflicht. Man habe über die Umstände des Kaufs von B1 (Automarkt) aufgeklärt. Sogar ungefragt. Jedenfalls hätte der K den Vertrag seinerzeit anfechten können. Die Frist sei nun (Prozess spielt 2013; Übergabe war am 20.4.11, Zahlungsaufforderung ging am 20.2.13 zu; Klage wurde im Mai anhängig) abgelaufen und die Anfechtungsfrist gelte, weil sie sonst leerliefe, auch für die Sachmängelgewährleistung. Jedenfalls sei der Anspruch aber verjährt (§ 438 BGB) und die Gewährleistung lt. Kaufvertragsurkunde (stimmt insoweit) ja eh ausgeschlossen. (Im KV war handschriftlich auch angegeben, dass der Wagen nur den Bagatellschaden aufweist).
Der K bleibt in der Replik dabei, dass die Schäden vorlagen. Die Umstände rund um den Parkunfall gibt er zu, trägt aber vor, Schuld sei ein Bremsversagen; er habe auch rechtzeitig - wenngleich vergegblich - gebremst). Zur Herkunft (Automarkt) sei keine Aufklärung erfolgt.
Das Gericht hat dann Beweis erhoben:
Durch persönliche Anhörung aller Parteien und durch Vernehmung dreier Zeugen (Vater und Großvater des K und Mitarbeiter des B2).
Der K sagt, er sei nicht aufgeklärt worden. Der B2 habe außerdem am Ende geäußert "ich an Ihrer Stelle würde den Wagen nehmen"; er habe aber auch immer gesagt, dass er für den B1 handelt und sich auf dessen Angaben berufen.
Der B2 bestreitet alles, sein Mitarbeiter könne das auch alles bestätigen. Insbesondere habe er über den Umstand "Automarkt" aufgeklärt.
Der B1 sagt nur, dass er dem B2 das mit dem Automarkt gesagt hat.
Der Zeuge 1 (Vater) sagt, dass er den B2 nach Vorschäden gefragt habe; dieser habe - unter Verweis auf die Angaben des B1 - gesagt, es lägen nur die aus dem Inserat vor. Der Mitarbeiter war bei den Gesprächen zum Zustand des Wagens nicht anwesend, sondern mit einer anderen Frau, die nachher die Getränke brachte, rausgegangen.
Der Zeuge 2 (Opa) sagt, er sei selbst bei den Gesprächen zum Zustand des Wagens nicht dabei gewesen; der Zeuge 3 aber auch nicht.
Der Zeuge 3 (Mitarbeiter) bestätigt, dass er nicht zugegen war.
___________________________________________
Z 2
Ausgangskonstellation:
Anwaltsklausur. Wir waren Beklagtenanwalt. Es gab einen Kläger und zwei Beklagte. B1 war unser Mandant, B2 dessen Kfz-Haftpflichtversicherung. Klage vorm Amtsgericht. Drei Anträge.
1.) Schadensersatz für einen beschädigten PKW (Totalschaden) + Zinsen: 1.700 €
2.) Freistellung von Ansprüchen des Vermieters V: 3.000 €
3.) Freistellung von vorgerichtlichen RA-Kosten: ~229 €
Es soll ein Schreiben ans Gericht gefertigt werden. In dem Fall war ein Schreiben an den Mandanten in jeden Fall entbehrlich. Auch Schreiben an die Versicherung und an den / bzgl des V sind erlassen.
Mandant kommt einen Tag nach Zustellung der Klage zu uns und schildert folgenden Sachverhalt (der im Tatsächlichen unstreitig sein dürfte):
Er habe vor zwei Jahren zusammen mit dem Kläger einen "Garagen-"Parkplatz bei V gemietet (Mietvertrag ist von beiden unterschrieben), der 500 € im Monat kostet. Beide sind "Autobastler" und nutzen den Parkplatz zum Basteln und Schrauben. Eines Tages (13.3.13) habe unser Mandant bemerkt, dass sein privater Wagen nicht mehr zog. Er hat ihn dann in die Garage / Parkplatz verbracht und dort am 16.3. untersucht. Dazu hat er den Motor eingeschaltet und den Wagen vor- und rückwärts bewegt, um besser an bestimmte Stellen des Wagens zu kommen. Er habe dann den Fehler gefunden, behoben und den Motor abgestellt. Der Zündschlüssel blieb stecken. Er wollte eine Probefahrt machen, räumte aber erst noch die Garage auf und wollte noch in die Wohnung um seine Jacke zu holen. Als er die Garage gerade verlassen will, bemerkt er, dass sein Wagen Feuer gefangen hat. Er versucht das mit einem Feuerlöscher zu löschen, was misslingt, weswegen er die Feuerwehr ruft, die den Wagen löscht. Das Feuer hat auch auf das Auto des Klägers übergegriffen, das dadurch einen Totalschaden erlitt (1.700 € Wert).
Der Vermieter musste leider auch die Garage an der Stelle sanieren. Kosten unstreitig 3.000 €.
Der Kläger hat beide Beklagten gemahnt und danach dann einen RA eingeschaltet, der auch beide Beklagten vorgerichtlichlich gemahnt hat.
Dann kommen so Allgemeine Versicherungsbedingungen (AKB) ins Spiel, die zwischen der Beklagten zu 2) und unserem Mandanten gelten. Darin steht u.a., dass die Versicherung den Versicherungsnehmer von Schadensersatzansprüchen freistellt, die "bei Gebrauch" des Kfz entstehen.
Außerdem gibt es ein Sachverständigengutachten aus einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen unseren Mandanten (in dieser Sache; nach § 170 II StPO eingestellt), das sich zur Brandursache verhält. Danach wurde der Brand wegen "Alterung des Materials" verursacht. Dadurch dass der Motor an war, hat sich alles total erhitzt und dann gab's ein explosives Gemisch und hat den Brand verursacht. Allerdings ist der letztlich ursächliche Ablauf erst dann von statten gegangen, als der Motor schon wieder abgestellt war. Ob der Mandant erkennen konnte, dass Ungemach drohte, konnte "nicht mehr festgestellt" werden.
Der Kläger führt in seiner Klageschrift noch aus, der Mandant hätte erkennen können, dass vom Wagen Ungemach drohte. Beweis bietet er nicht an. Auch sei der Wagen "in Betrieb" gewesen, weswegen eine Haftung nach § 7 I StVG bestünde. Dazu trägt er allerhand (u.a.) lustiges vor: So läge "Betrieb" vor, weil er am 13. (also 3 Tage vorher) noch gefahren sei :) Außerdem weil er den Wagen vor und zurück gesetzt habe. Zudem, weil der Zündschlüssel steckte und schließlich weil ja auch in den AKG eine Haftung für "bei Gebrauch" bestehe, wozu ja auch die Reparatur zähle, und das sei ja wie "in Betrieb" zu verstehen. Die Versicherung hafte jedenfalls wegen den AKB.
Der Mandant fragt nun, ob er denn zahlen (und freistellen) müsse. Ihm täte das alles total Leid, aber ihn treffe doch gar keine Schuld. Außerdem wollte er wissen warum der Klägeranwalt so auf dem Begriff "in Betrieb" rumhackt. Auch gegenüber dem V treffe ihn doch keine Schuld. Er will außerdem wissen, ob die B2 auch haftet, und ob er deswegen dann in der Versicherung "hochgestuft" wird. Dann sagt er, er habe während der Sanierungszeit, als die Garage nicht nutzbar war, die Miete weiter voll gezahlt, ob man das nicht dem V entgegen halten ("abziehen") könne.
Ferner habe er mit dem Kläger vereinbart, dass die Miete per Dauerauftrag zunächst von seinem Konto abgebucht wird, dieser ihm dann aber die Hälfte (250,- €) überweist. Das habe auch zwischen Feb. 11 und Juli 12 so geklappt. Dann sei der Kläger arbeitslos geworden. Er habe seit August 12 keinen Cent mehr von der Miete erstattet.
Weil der Kläger ihn nun verklagt, wolle er das Geld "in dem Prozess" wiederhaben. Er fragt, was man da machen könne.
_______________________________________
Z 3
Die Entscheidung des Amtsgerichts Düsseldorf war zu entwerfen. Kläger beruft sich auf Sicherungseigentum an einem PKW, Beklagte ist eine Vertriebsgesellschaft mbH, die im Juli 2011 ein VU über 4.500 € gegen die Tochter/den Schwiegersohn des Klägers erwirkt hat.
Die Tochter kümmert sich um die erkrankte Schwiegermutter. Das findet der Kläger toll und gewährt ihr (und ihrem Mann) im Mai 2011 ein Bar-Darlehen in Höhe von 12.000 € (streitig) zum Erwerb eines Autos (Kauf zum Kaufpreis 11.900 € im Juni 2011), damit die Tochter aus Düsseldorf die Mutter aus Hürth besser erreichen kann. Das ganze soll auf keinen Fall eine Schenkung sein und Rückzahlung der Valuta wird auf den 31.12.2010 bestimmt. Die Tochter bespricht mit ihrem Mann, dass man dem Vater doch eine Sicherheit geben sollte. Sie schickt dem Kläger per Einschreiben den Kfz-Brief samt Schreiben, in dem sie sich nochmal für das Geld bedankt und äußert, dass das Auto dem Vater "gehören" solle (streitig), bis die Eheleute ihm das Geld zurückgezahlt haben. Der Vater erklärt nicht ausdrücklich die Annahme, ist aber einverstanden und behält den Kfz-Brief. Das Schreiben der Tochter ist zwischenzeitlich "futsch".
Am 4. Juni 2013 pfändet der GV das Auto bei den Eheleuten zur Vollstreckung des VU. Die GV kündigt am 5.6. an, dass die Versteigerung auf den 1.8. terminiert ist, sollten die 4.500 € nicht bis dahin beglichen werden. Der Kläger-RA schreibt am 12.6. unter Vorlage einer e.V. von sich und seiner Tochter und widerspricht der Pfändung und der Verwertung. Nachdem nichts passiert, erhebt er im Juli 2013 Drittwiderspruchsklage. Am 5.8. teilt der Beklagten-RA mit, dass inzwischen das Auto versteigert ist (4.650 €) und 4.000 € an die Bekl. ausgekehrt worden sei.
Der Kläger stellt daraufhin seinen Klageantrag auf Zahlung des Erlöses + Schadensersatz (insg. 6.000 €) um. Das Auto hat unstreitig einen solchen Zeitwert gehabt.
Die Beklagte rügt nun die Zuständigkeit des Gerichts (6.000 € sei doch eine Sache für das LG). Außerdem sei die Übereignung, so sie denn überhaupt stattgefunden habe, als Scheingeschäft nichtig, da die Eheleute doch eigentlich nur Vermögensmasse beiseite schaffen wollte. Jedenfalls sei die Übereignung auch nicht durch Übergabe des Kfz-Briefs erfolgt. Außerdem erklärt er die Anfechtung wegen Gläubigerbenachteiligung nach dem AnfG. Ferner verstieße das Ganze gegen Treu und Glauben. Immerhin habe der Kläger die Valuta bis heute nicht zurückgefordert. Dem Kläger ginge es doch gar nicht um seine eigenen Interessen sondern nur darum, den Eheleuten den Wagen bzw. die Surrogate zu verschaffen. Schließlich trage der Kläger aber ein überwiegendes Verschulden daran, dass der Wagen "unter Wert" versteigert wurde. Er hätte ja einen Vollstreckungsschutzantrag stellen können.
Der Kläger repliziert u.a., dass er sehr wohl ein Interesse habe. Schließlich ginge es ihm nun nicht mehr darum, den "Kindern" das Auto zu erhalten, sondern er wolle nun selbst vom Wert des Wagens (der ja schließlich der Sicherung seines Darlehens diente) partizipieren. Er habe das Darlehen aufgrund der familiären Verbundenheit bisher nicht zurückgefordert.
Die Beklagte schreibt darauf nicht mehr.
Das Gericht erhebt Beweis durch Vernehmung der Eheleute.
Die Tochter bestätigt den Erhalt und den Zweck des Geldes. Man habe das Auto auch mit diesen Mitteln gekauft. An das alles könne sie sich u.a. auch noch deshalb erinnern, da der Kläger ihr das Geld an ihrem Geburtstag im Mai in Aussicht gestellt habe. Es sei klar gewesen, dass dem keine Schenkung zugrunde liege, sondern der Kläger das Geld zurückerhalten sollte. Sie habe dann mit ihrem Mann besprochen, dass man den Kläger "absichern" solle und den Kfz-Brief per Einschreiben an den Kläger versandt. Sie habe sich bedankt und dabei geschrieben, dass das Auto "dem Vater gehören" solle bis das Geld zurückgezahlt sei.
Der Ehemann bestätigt das alles. Er habe das Schreiben zwar nicht selbst gelesen, aber seine Frau habe es ihm bei der Arbeit am Telefon vorgelesen. Für ihn sei das so gewesen, wie wenn die Bank einen Kredit gibt und man ihr dann dafür Sicherheiten gibt. So sei das ja auch hier. Der Kläger sei die Bank und das Auto diene nun seiner Absicherung.
_____________________________________
Z 4
Anwaltsklausur. Klage vorm Landgericht Düsseldorf (definitiv ;) kein Aktenzeichen im Aktenauszug). Wir waren Anwalt der Beklagten, einer GmbH aus D'Dorf. Die Klägerin war eine GmbH & Co. KG aus Aachen.
Die Klägerin verkauft Autos an diverse Kunden. Die Beklagte ist eine Leasinggesellschaft, die in die Kaufverträge mit Zustimmung der Kunden eintritt und die Autos dann an die Kunden "verleast". Die Klägerin und die Beklagte machen das, insb. mit dem Kunden H (AG), schon seit vielen Jahren so.
Drei Anträge:
1.) Zahlung von 65.000 € aufgrund der Kaufverträge zzgl. Zinsen (8-%-Punkte)
2.) Rechtsanwaltskosten als Verzugsschaden (ca. 1.800 €)
3.) Feststellung, dass die Klägerin nicht verpflichtet ist, aus einer Rückkaufvereinbarung an die Beklagte zu zahlen.
Zum Sachverhalt im Übrigen:
Der Klageantrag zu 1) stützt sich auf Kaufverträge, in die die Beklagte - wie üblich - "beigetreten" ist. Dem Grunde nach ist der Anspruch auch unstreitig.
Die Klägerin forderte die Beklagte zur Zahlung auf. Die Beklagte weigert sich zu zahlen, da die Klägerin ihr noch einen Betrag in Höhe von 110.000 € schulde.
Dazu trägt die Beklagte wie folgt vor:
Beim Beitritt in die Kaufverträge schließt sie mit der Klägerin "Rückkaufvereinbarungen". Danach soll nach 24 Monaten die Klägerin verpflichtet sein, die Wagen - die die Bekl. bis dato pflegt - zu einem Prozentsatz von 46% des Restwertes zurückzukaufen, wenn er 100.000 km gelaufen ist. In den Bedingungen des "Rückkaufvertrages" ist u.a. auch geregelt, wie der Preis sich ändert, wenn der Wagen früher oder später zurückgegeben wird oder wenn er mehr oder weniger km gelaufen ist.
Die Bekl. sagt im Mandantengespräch u.a. auch noch, dass dieses Spielchen schon seit vielen Jahren so gespeilt werde, aber auch nur bei Geschäften unter Beteiligung der H-AG. Bei anderen Kunden gäbe es diese RÜckkaufvereinbarung nicht. Die H-AG und die Klägerin hätten diese 46% Regelung -so glaubt die Bekl. - auch schon vorher getroffen gehabt. Ferner lege die Kl. die Restwerte fest. Sie kenne sich damit ja auch viel besser aus.
Davon würden ja alle drei Parteien auch toll profitieren. Die Klägerin inbesondere deshalb, weil sie gepflegte Autos zurückerhalte. Aber auch, weil sie durch die Geschäfte mit der H-AG (die i.Ü. Stein des Anstoßes ist, weil sie den Verkäufer der Autos bestimmt und so die Kl. gewählt hat; nun aber in Zukunft den Verkäufer wechseln will) Millionenbeträge einnehme (die kaufen wohl jährlich an die 100 Autos für ihre Flotte).
Aus diesem Geschäft stünde ihr nun wegen 9 Rückkaufverpflichtungen ein Betrag in Höhe von 110.000 € zu (Höhe unbestr.). Damit hat sie dann auch vorprozessual die Aufrechnung erklärt, nachdem sie sich zuvor geweigert hatte, die 65.000 € zu begleichen, ehe nicht die 110.000 € bezahlt sind (ZbR?!)
Die Klägerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die Aufrechnung nicht zöge, weil sie ja in den Neuwagen Verkaufsbedingungen die Aufrechnung ausgeschlossen habe. In diesen Bedingungen ist die Aufrechnung "§ 309 Nr 3 BGB-konform" ausgeschlossen. Ferner ist das ZbR ausgeschlossen. (Außerdem ist als Gerichtsstand der Sitz der Klägerin ausgewiesen. Die Klage ist trotzdem in Düsseldorf anhängig).
Außerdem sei auch die Rückkaufvereinbarung unwirksam. Diese sei ja schließlich eine AGB, da sie von der Bekl. einseitig gestellt würden (sie legt eine exemplarische Beitrittserklärung "unter Vorbehalt der Unterzeichnung der Rückkaufvereinbarung" vor sowie die Rückkaufvereinbarung exemplarisch). Ferner sei darin ja nur ein Angebot und kein Vertragsschluss zu sehen. Insbesondere sei das ja auch wegen der "dynamischen Preise" keine Bedingung nach § 158 BGB und auch keine Option. Weiter sei aber auch die Annahmefrist nach § 307, 147 II BGB unangemessen lang, sie betrüge ja 24 Monate. Zudem sei die Berechnung des Rückkaufpreises für sie intransparent, und das Äquivalenzinteresse sei gestört. Außerdem widerspreche das alles auch der vertraglichen Risikoverteilung.
Nach der Abwrack-Prämie in 2009 seien auch die Gebrauchtwagenpreise drastisch eingebrochen (mind. 6%, Tendenz steigend - unstr.).
Der Antrag zu 2) sei begründet, da die Bekl. ja schließlich in Verzug sei ((a)Zahlungsaufforderung durch Kl. - (b) Weigerung unter Verweis auf offene 110.000 € durch Bekl.: Zahl bis Tag X. © Kl. widerspricht und fordert nun ihrerseits zur Zahlung bis Tag Y auf. (d) Bekl. erklärt die Aufrechnung. (e) Kl. beauftragt RA, der nun die Bekl. mahnt).
Die Mandantin möchte nun wissen, ob es sich lohnt, sich gegen die Klage zu verteidigen und wie bzgl. der Gegenforderung zu verfahren sei.
___________________________________________
S 1
Es gab einen Beschuldigten A, 20 Jahre alt und einmal wegen KV und Diebstahl vorbestraft (4 Wo. Jugendarrest), und einen gesondert Verfolgten S. Zu begutachten ist nur A. Ebenfalls soll nur bzgl. A die Entschließung der StA angefertigt werden. Der S ist chronisch pleite, hat 50.000 Euro Schulden und verdient 1.000 Euro im Monat. Der A, der das alles weiß (sagt jedenfalls der S im Rahmen eines allumfassenden Geständnisses nach ordnungsgemäßer Belehrung) arbeitet in der Kreditvergabe bei einer Bank. Der S fragt, wie viel er wohl verdienen muss, um einen Kredit in Höhe von 75.000 Euro zu bekommen. Der A berechnet ihm das mit 4.000 Euro.
Nun kündigt S ggü A an, er werde seine Gehaltsbescheinigungen beschönigen und aus den 1.000 mal 4.000 € machen. Gesagt getan. A gibt nun die Daten in das Kreditvergabeprogramm der Bank ein. Das Programm funktioniert so, dass es voll automatisiert die Daten zugrunde legt und prüft, ob ein Kredit vergeben werden kann oder nicht. Wenn der Antragsteller den Kredit voraussichtlich zurückzahlen kann, ist das ein "Grünfall". Dann wird der Kredit automatisch vom Programm genehmigt und das Geld automatisch ausgezahlt. Bei einem "Gelbfall" setzt sich nochmal ein Mitarbeiter an den Antrag und bei einem "Rotfall" gibt's die Ablehnung bereits vor Ort. Durch die Manipulation der Daten liegt nun ein "Grünfall" vor, statt, wie bei 1000 €, ein Rotfall. A soll für seine "Dienste" vom S 5.000 € bekommen, die bisher aber nicht ausgezahlt wurden. S lässt sich u.a. noch dahingehend ein, dass er das Geld nie hätte zurückzahlen können und wollen (was A auch wissen dürfte). Die Unterlagen, die der Kreditvergabe zugrundeliegen, werden von der Verwaltung gesammelt.
Das Geld wird ausgezahlt. Der Bank fällt eine Ungereimtheit auf und es kommt zur Strafanzeige. Es ergeht ein Durchsuchungsbeschluss (alles ordnungsgemäß laut Hinweis LJPA), der sich auf die in der Whg des A befindlichen Sachen, einschließlich PC erstreckt. Bei der Durchsuchung finden die Ermittlungsbeamten der Polizei auf dem Schreibtisch ein mit "Zahlungsaufforderung" überschriebenes "Erpresserschreiben", dass an die Bank adressiert und als "Entwurf" gekennzeichnet ist. Darin droht der Verfasser an, das Onlinebanking Portal der Bank lahmzulegen, wenn man ihm nicht zu einer näher zu bestimmenden Zeit 50.000 Euro zahlen werde. Außerdem findet die Polizei auf dem PC eine Software, die durch das LKA als Schadsoftware (DoS-Angriff) begutachtet wird, die das Portal der Bank durchaus für mehrere Stunden lahmlegen kann. Als man diese gerade gefunden hat, taucht A plötzlich von hinten auf und sagt, er habe die Software als Computerfan hergestellt, das sei ja wohl nicht strafbar. Dann sei er wieder gegangen. Man habe Schreiben und Software (ordnungsgemäß) beschlagnahmt.
Der Wahlverteidiger des A widerspricht der Verwertung von Schreiben und Software. Die Sachen seien vom Durchsuchungsbeschluss nicht umfasst gewesen (Zufallsfund).
____________________________
S 2
Urteilsklausur. Drei Angeklagte. Kostenentscheidung ebenso erlassen wie die Feststellungen zur Person; auch ein Haftfortdauerbeschluss und auch ein etwaiger Bewährungsbeschluss waren nicht anzufertigen. Im Übrigen die üblichen Bearbeitervermerke, insb. zur Strafzumessung. Strafanträge waren gestellt und alle Aussagegenehmigungen und Belehrungen etc. lagen vor.
Die Straftatbestände der §§ 123, 164, 180, 180a, 323c StGB waren erlassen.
Tatvorwürfe aus dem Bereich der Tötungsdelikte, dazu später mehr.
Zu den Protagonisten:
Der Angeklagte M. ist im Rotlichtmilieu tätig. Hierüber kennt er auch den Angeklagten Herrn A (A). Die Angeklagte Frau A (F), die Ehefrau des A, ist die Tochter des verstorbenen Lebensgefährten des Opfers sowie deren testamentarische Alleinerbin. Das Opfer war 77 Jahre alt und wohnte alleine in einem Mehrfamilienhaus (10 Einheiten).
Die Anklagevorwürfe:
M und A sind wegen gemeinschaftlichen Mordes aus Habgier sowie gemeinschaftlichen Raubes angeklagt.
Die F wegen Beihilfe zum Mord aus Habgier.
Alle drei sitzen auch brav in Haft (alles ordnungsgemäß erlassen).
Der Sachverhalt:
Der A betreibt einen Bordellbetrieb und vermietet zu dem Zweck Wohnungen in einem ihm gehörenden Haus an Prostituierte. Der M überwacht diese. Das ganze rentiert sich aber nicht und A kann einen Kredit für dieses Haus daher nicht ordentlich bedienen. Die F fordert ihn auf, das Haus zu verkaufen und auch das Opfer (O) stellt sich auf die Seite der F. Darüber ist A erbost und im Stolz gekränkt. Er ist außerdem sauer, dass die O i.wann mal bei i.einem PKW-Verkauf nicht so gehandelt hat wie das zwischen A und O abgesprochen war. Er spielt mit dem Gedanken, die von ihm als vermögend bekannte O zu "beseitigen". Das war Mitte 2012. Januar 2013 wendet er sich dann an den M und bietet ihm 23.000 € für die Tötung an und zudem darf M sich an dem Schmuck der O bereichern. M geht drauf ein und A weist ihn nun darauf hin, wie O heißt, wo sie wohnt und wo der Schmuck versteckt ist. Außerdem fährt er auch mal gemeinsam mit M zu dem Haus. Schließlich gibt er ihm am 14.3. den Tipp, dass O am 16.3. allein zuhause ist.
M fährt am 16.3. zu der Wohnung, und trifft in der Diele auf O, die schreit. Er schlägt sie und erwürgt sie schließlich. I.wann währenddessen oder danach sammelt er den Schmuck zusammen. Beim Verlassen, O ist bereits tot und ihr wurde bei der Würgeattacke auch das Zungenbein gebrochen, hebt er vom Boden ein Mobiltelefon der O auf und steckt es ein.
Der A ruft am Folgetag die Polizei zu der Leiche. Das Handy wird nach 10 Tagen mit einer dem M zuzuordnenden Telefonnummer geortet und ein Anruf mit A wird festgestellt. Als die Polizeibeamten zu dem Haus des A und der F fahren und klingeln, öffnet F und schreit dann den A an, "ich hab doch gesagt, du sollst das lassen. Das hast Du nun von Deiner Geldgier und Deinem Stolz". Beide werden festgenommen.
Die F sagt nichts aus. Der A - ordnungsgemäß belehrt - verzichtet auf einen Verteidiger und erzählt den Beamten erstmal einen vom Pferd. Nach mehreren Stunden (das Verhör dauert insg. fast 8 Stunden) räumt er den Tatvorwurf (wie oben beschrieben) ein, sagt aber, er habe M den Schlüssel nicht gegeben und er wisse auch nicht wie M die Tat begangen habe und mit wem.
Der M "gesteht" auch die Vorgeschichte meint aber, er habe O nie töten wollen. Er wollte den A nur um die 23.000 € erleichtern und den Schmuck haben. Er habe den Bekannten "Sunny" aus Belgien kontaktiert, der 20-30 J. alt sei, 180 cm groß, dunkle Haare, und ihm von dem Plan erzählt. Gemeinsam mit "Sunny", dessen augenblicklichen Aufenthaltsort er nicht kenne und der auch nicht ermittelt werden konnte, habe er die Diele betreten. Als O geschrien habe, habe er ihr einen Schlag gegen den Mund versetzt. Der Sunny habe sich dann weiter um sie gekümmert und er, also M, habe den Schmuck (Wert 12.000 €) zusammengesucht. Als er die Whg verlassen habe, sei O noch am Leben gewesen. Das habe er gesehen, denn die Augen hätten sich bewegt. Dann habe er das Handy eingesteckt.
Auf der Leiche wurden DNA Spuren sichergestellt, ebenso an den Schränken. Diese stammten von einer männlichen Person. Weitere DNA Spuren gab es nicht, insb. nicht von einer weiteren Person. Diese befanden sich u.a. auch am Hals der O. Die Eingangstür war laut KTU Bericht unversehrt und auch die Fenster waren in Ordnung und verschlossen.
Die DNA stammte von M.
A sagte noch, dass er seiner Frau ggü sein Vorhaben angedeutet habe. Diese habe ihn aufgefordert davon Abstand zu nehmen. Er, A, habe aber darauf vertraut, dass F ihn schon nicht anzeigen werde. Außerdem habe er damit gerechnet, dass F das Erbe, das er vermutete, mit ihm teilen werde.
M sagte zu Fs Wissen befragt aus, dass er dazu nichts genaues wisse. Ihm sei nur wichtig gewesen, dass keine Anzeige drohe. Zu den Erbbeteiligungen wisse er nichts. Das sei ihm aber auch egal gewesen.
Vor Gericht:
A und F sagen nicht aus, von M wird durch den Anwalt eine Einlassung (s.o.) verlesen. Dann werden die Polizeibeamten vernommen und bestätigen die Aussagen des A und der F vor Ort.
Der Verteidiger des A widerspricht der Verwertung der Aussage zu der Einlassung des A. Dieser sei ermüdet gewesen bei der Vernehmung. Das können die Zeugen nicht bestätigen. Es habe keine ANzeichen dafür gegeben, A habe auch nichts dahingehend verlautbart. Außerdem habe er zwischen 0:45 Uhr und 7:00 Uhr im Haftraum geschlafen; man habe ihn jedenfalls um 7:00 Uhr geweckt und auch erst um 11:00 Uhr in den Vernehmungsraum verbracht.
Der Verteidiger der F widerspricht zudem der Äußerung der F damals an der Tür (Spontanäußerung).
Außerdem erstatten die drei Sachverständigen ihre Gutachten (Todesursache und Verletzungen; Zustand der Wohnung / Türen / Fenster; DNA)
________________________________________________
V 1
Einstweiliger Rechtsschutz, Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage gegen einen Rückforderungsbescheid in Gestalt eines Widerspruchbescheides.
Der Antragsteller (Ast) wendet sich gegen die BRD, vertreten durch das BMVg, vertreten durch das BVA. Dieses will vom ihm ca. 2.300 € zurückhaben, die sie, die Antragsgegnerin (Ag), zu viel an den Ast. gezahlt hat.
Unser Ast. ist Berufssoldat der Bundeswehr. Er hat einen Hauptschulabschluss, eine abgeschlossene Ausbildung als Dreher und ein Staatsexamen als Rettungsassistent. Seit 2006 ist er bei den "Fliegern" aktiv und erhält aufgrund eines Bewilligungsbescheides aus 2006 eine Zulage nach einer Anlage zur Besoldungsordnung zum BBesG. Diese sieht vier Kategorien vor. Drei für Flugzeugführer und eine für sonst. selbständige Luftfahrzeugangehörige. Unser Ast. gehört nach der Bewilligung in die letztgenannte Klasse (ca. 290 €), bei der es auch am wenigsten Zulage gibt. Im Jahr 2011 vertippt sich ein Mitarbeiter des BVA und seither bekommt der Ast. eine höhere Zulage (ca. 360 €), obschon er weiterhin der Kat. 4 angehört. Im August 2013 wird er versetzt und ist grds. nicht mehr zulagenberechtigt, sofern nicht eine Ausnahmeregelung aus der Anlage zum BBesG greift. Das BVA prüft, ob diese Ausnahme vorliegt und entdeckt den Fehler, der dem Ast. zwischen 2011 und Mitte 2013 ein Plus von knapp 2.300 € beschert hat. Mit der "richtigen" Zulage verdient er ca. 2.780 €, mit der "falschen" ca. 2.850 €. Das wird durch Gehaltsbescheinigungen ausgewiesen. Diese sind zudem nach den jeweiligen Bezügeposten (Gehalt, Zulage A, B, C, ... etc.) aufgeschlüsselt, wobei in den alten Bescheinigungen "Zulage Flieg Personal (IV) aktiv" steht und in den neuen "Zulage Flieg Personal (II) aktiv, rgf" steht.
Man hört den Ast. an und erlässt dann einen Rückforderungsbescheid mit ASV. Der Ast. erhebt dagegen Widerspruch und es ergeht ein bestätigender Widerspruchsbescheid. Der Ast. erhebt nach 10 Tagen Klage und stellt den hiesigen Antrag.
Inhaltlich trägt die Ag. vor, dem Ast. hätte der Fehler auffallen und er hätte ihn melden müssen. Er könne sich auch nicht, wie es der Ast. im Widerspruch macht, auf Entreicherung berufen, da dies nur bei Luxusaufwendungen möglich sei. Nicht jedoch sei dies bei Aufwendungen zur Verbesserung des Lebensstandards möglich. Die ASV begründete man mit dem "öffentlichen Interesse an der Rückzahlung zuviel gezahlter Beträge" und der "offensichtlichen Rechtmäßigkeit des Rückforderungsbescheides".
Im Verfahren trägt der Ast. vor, dass die ASV nicht ausreichend begründet sei und der Antrag schon allein deshalb voll Erfolg haben müsse. Jedenfalls sei der VA aber rechtswidrig und er in seinen Rechten verletzt. Denn der VA sei schon zu unbestimmt, da sich nicht ergebe, wie sich der Rückforderungsbetrag rechnerisch zusammensetze. Jedenfalls stellten aber die ihm übermittelten Gehaltsbescheinigungen einen Rechtsgrund zum Behaltendürfen dar. Auch sei er ja entreichert, auch wenn er nicht mehr genau nachweisen könne, wofür er die Aufwendungen getätigt habe. Auch Aufwendungen zur Verbesserung des Lebensstandards könnten zu Entreicherung führen. Der Lebensstandard richte sich nach den Bezügen. Jedenfalls sei der Fehler aber für ihn, zumal er nur über einen Hauptschulabschluss und eine Ausbildung zum Dreher verfüge, nicht erkennbar gewesen. Die Gehaltsbescheinigungen seien verwirrend und abschreckend gewesen. Auch trage die Ag. ein erhebliches Mitverschulden und er beruft sich auf die Einrede der Verjährung.
Die Ag. trägt vor, dass die ASV sehr wohl ausreichend begründet sei, jedenfalls könne das dem Antrag aber nicht zum Vollerfolg verhelfen. Sie legt vor der Entscheidung eine Tabelle vor, in der Erhaltene und Zustehende Beträge gegenübergestellt werden (für alle Monate) und am Ende die Differenz ausgewiesen wird. Damit sei ein etwaiger Fehler doch nun geheilt. Die Gehaltsbescheinigungen seien keine VAe und damit kein Rechtsgrund im Sinne des § 812 BGB. Der Ast. könne sich auch nicht auf Entreicherung berufen. Auch war der Fehler für ihn erkennbar, und zwar durch einen simplen Vergleich der Bescheinigungen, und es sei ja sowieso auf die Kenntnis des Empfängers abzustellen. Wenn sie überhaupt ein Mitverschulden treffe, sei das jedenfalls nur auf leichter Fahrlässigkeit begründet und das Mitverschulden des Ast. überwiege. Auch aus Billigkeitsgesichtsgründen stünde dem Ast. das Geld nicht zu. Letztlich läge zudem weder ein Fall von Verwirkung noch von Verjährung vor.
Laut Bearbeitervermerk war der Streitwertbeschluss erlassen. Im Falle der Unzulässigkeit war ein Hilfsgutachten gefordert und es sollte "in jedem Falle" auf die Rechtmäßigkeit des Rückforderungsbescheides eingegangen werden. Die Entscheidung sollte am 14.11.2013 ergehen, während die Sitzung am 13.11.2013 stattfand.
Die Ermächtigungsgrundlage war in den Bescheiden angegeben: § 12 II 1 BBesG i.V.m. §§ 812 ff. BGB.
________________________________________________
V 2
Es war eine Anwaltsklausur. Wir waren Vertreter des Privaten/Anspruchstellers.
Unsere Mandantin ist eine große Zirkus GmbH. Diese zieht jährlich quer durch die Republik. Sie legt dabei die Tournee-Halte so, dass sie möglichst schnell und kostengünstig von Ort A nach Ort B und so weiter kommt. Zu ihrem Reportoire gehören neben Auftritten mit Haustieren auch solche mit "exotischen Tieren". Sie verfügt des Weiteren über eine Erlaubnis nach § 11 I 1 Nr. 3d TierSchG (nunmehr Nr. 8d).
Die Stadt vergibt einen Veranstaltungsplatz (um den es später gehen wird) regelmäßig auf dem Wege, dass sie in einem ersten Schritt die Genehmigung (durch öff.-rechtlichen Vertrag) vergibt und das "Wie" durch privatrechtlichen Vertrag regelt.
Im Januar und nochmal konkreter im März 2013 beantragt sie bei der Stadt Bonn, unserer Antragsgegnerin, die Zulassung zu einem Platz in Bonn (vor der Beethovenhalle), wo sie den Zirkus stattfinden lassen kann. Sie gibt den Zeitraum mit Mitte März bis Mitte April 2014 an. Ferner reicht sie ein Programmheft bei, aus dem hervorgeht, dass die M auch Auftritte mit Exoten im Reportoire hat. Die Stadt schreibt darauf im Mai sinngemäß, dass auf die Anfrage aus dem März die Mandantin nunmehr für ihr Gastspiel "für den Zeitraum Mitte März bis Mitte April 2014 vorgesehen" sei. Sie solle die konkreteren Planungen mitteilen. Das macht M und gibt den Zeitraum 14.3. bis 28.3.14 an (ein Tag Auf- und Abbau eingerechnet, das eigentliche Gastspiel dauert 12 Tage). Dann passiert lange nichts. Im September verweist die Stadt auf einen inzwischen ergangenen (formell rechtmäßigen) Ratsbeschluss, der "im Namen des Tierschutzes" vorsieht, dass Bewerber bestimmte Unterlagen (die auch im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach § 11 TierSchG eine Rolle spielen) vorgezeigt werden, bevor der "Ob"-Vertrag geschlossen werden darf. Außerdem seien Wildtiere / Exoten fortan auszuschließen. Das sei aus Gründen des Tierschutzes geboten.
Unsere M (aus München) schaltet einen RA in München ein, der der Stadt schreibt, dass er den Ratsbeschluss für rechtswidrig hält. Es gebe keine Ermächtigungsgrundlage und die Stadt sei ja für Tierschutzangelegenheiten auch gar nicht zuständig. Ferner verstieße das Verbot von Exoten gegen das TierSchG. Die Stadt erwidert, dass sie an den Ratsbeschluss gebunden sei und das ja auch alles rechtmäßiger weise dem TierSchutz diene.
Die M will eine schnelle Lösung (lt. BV würde ein "Normales" Verfahren auch nicht vor Mai 2014 zu einer Entscheidung führen). Sie meint, dass in der ersten Mail der Stadt eine verbindliche Zusage zu sehen sei. Fortan habe sich auch die Sach- und Rechtslage nicht mehr geändert. Hilfsweise habe sie einen Zulassungsanspruch aus § 8 GO NRW. Sie legt noch eine eidesstattliche Versicherung vor, wonach kein Ausweichort vorhanden sei und sie mit Einnahmen von Rund 880.000 € für die 12 Tage rechnen könne. Ferner habe sie Fixkosten in Höhe von rund 360.000 €.
Ausgangskonstellation:
Klage vorm Landgericht. 1 Kläger, 2 Beklagte. Kläger ist Privatmann, B 1 ist Privatmann und B 2 ist Inhaber eines Gebrauchtwagenhandels. Prozessuale Nebenentscheidungen waren erlassen.
Kläger begehrt Schadensersatz nach Autokauf (im Jahr 2011) in Höhe von 5.000 Euro + Verzugszinsen sowie die Feststellung, dass die Verpflichtung nach dem Antrag zu 1) auf einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung beruht (Wert nach Streitwertbeschluss: 500 €). Die Beklagten beantragen Klageabweisung. Sie rechnen hilfsweise mit einer Forderung aus einem Autounfall (der Kläger ist - unstreitig - am Morgen des Kaufs beim Einparken in das ordnungsgemäß parkende Auto des Beklagten zu 2) reingedonnert, weil seine Bremsen versagt haben) in Höhe von 1,700 € auf. Der Beklagte zu 2) macht den Anspruch (der der Höhe nach unbestritten ist; der Kläger meint nur, er habe den Unfall nicht zu verschulden und er sei auch unabwendbar gewesen) ferner im Wege der Hilfswiderklage geltend.
Der Beklagte zu 2) hat den Kaufvertrag (Kaufpreis 9.000 €; Wagen war vom B 1 via Internet inseriert; Dort fand sich die Angabe "- gut gepflegt und -Bagatellschaden, ordnungsgemäß repariert) ausdrücklich im Namen des B 1 geschlossen und auch mit "i.V." den Vertrag unterschrieben; dieser hat ihm dafür eine Provision gezahlt.
Der Kläger verkauft den Wagen später (auch 2011) an einen Dritten zu 4.000 Euro weiter (--> Klageforderung = 9.000 - 4.000), nachdem er ihn erst für 8.500 Euro verkaufen wollte. Der Dritte, der bei einer Werkstatt arbeitet, will aber festgestellt haben, dass der Wagen erhebliche Vorschäden aufweist. Hierzu wird Beweis angeboten (Zeuge, Sachverständigengutachten); Beweis wird aber in der anschließenden Beweisaufnahme nicht erhoben. Der Wert des Wagen lag - unbestritten - zwischen 3.500 und 4.500 Euro.
Im Kfz-Brief ist ein Vorhalter eingetragen.
Zur Klage:
Der Kläger macht geltend, dass man ihn über die Vorschäden getäuscht habe; man habe ihn darüber aufklären müssen (insb. da er ausdrücklich gefragt hatte, ob das die einzigen Schäden seien); auch habe man ihn über die Anzahl der Vorbesitzer aufklären müssen (dass die abweichend vom Kfz-Brief war, ging aber m.E. aus dem SV nicht hervor). Ferner habe der B2 wahrheitswidrig beim Verkauf gesagt, dass der B1 den Wagen von einem Arbeitskollegen gekauft habe; in Wirklichkeit - das wird nachher unstreitig - wurde er aber auf einem Automarkt von einem unbekannten Händler gekauft. Ob der für den eingetragenen Ersthalter gehandelt hat, bleibt unaufgeklärt. In Kenntnis all dessen hätte er den KV nicht abgeschlossen. Er meint ferner, der Aufrechnung stünde ein Aufrechnungsverbot entgegen (§ 393 BGB?) und die Aufrechnung wirke ja eh nur für den B2 (sein Auto wurde beschädigt).
Die Beklagten bestreiten die Mängel. Sie hätten aber jedenfalls keine Kenntnis gehabt und daher auch keine Aufklärungspflicht. Man habe über die Umstände des Kaufs von B1 (Automarkt) aufgeklärt. Sogar ungefragt. Jedenfalls hätte der K den Vertrag seinerzeit anfechten können. Die Frist sei nun (Prozess spielt 2013; Übergabe war am 20.4.11, Zahlungsaufforderung ging am 20.2.13 zu; Klage wurde im Mai anhängig) abgelaufen und die Anfechtungsfrist gelte, weil sie sonst leerliefe, auch für die Sachmängelgewährleistung. Jedenfalls sei der Anspruch aber verjährt (§ 438 BGB) und die Gewährleistung lt. Kaufvertragsurkunde (stimmt insoweit) ja eh ausgeschlossen. (Im KV war handschriftlich auch angegeben, dass der Wagen nur den Bagatellschaden aufweist).
Der K bleibt in der Replik dabei, dass die Schäden vorlagen. Die Umstände rund um den Parkunfall gibt er zu, trägt aber vor, Schuld sei ein Bremsversagen; er habe auch rechtzeitig - wenngleich vergegblich - gebremst). Zur Herkunft (Automarkt) sei keine Aufklärung erfolgt.
Das Gericht hat dann Beweis erhoben:
Durch persönliche Anhörung aller Parteien und durch Vernehmung dreier Zeugen (Vater und Großvater des K und Mitarbeiter des B2).
Der K sagt, er sei nicht aufgeklärt worden. Der B2 habe außerdem am Ende geäußert "ich an Ihrer Stelle würde den Wagen nehmen"; er habe aber auch immer gesagt, dass er für den B1 handelt und sich auf dessen Angaben berufen.
Der B2 bestreitet alles, sein Mitarbeiter könne das auch alles bestätigen. Insbesondere habe er über den Umstand "Automarkt" aufgeklärt.
Der B1 sagt nur, dass er dem B2 das mit dem Automarkt gesagt hat.
Der Zeuge 1 (Vater) sagt, dass er den B2 nach Vorschäden gefragt habe; dieser habe - unter Verweis auf die Angaben des B1 - gesagt, es lägen nur die aus dem Inserat vor. Der Mitarbeiter war bei den Gesprächen zum Zustand des Wagens nicht anwesend, sondern mit einer anderen Frau, die nachher die Getränke brachte, rausgegangen.
Der Zeuge 2 (Opa) sagt, er sei selbst bei den Gesprächen zum Zustand des Wagens nicht dabei gewesen; der Zeuge 3 aber auch nicht.
Der Zeuge 3 (Mitarbeiter) bestätigt, dass er nicht zugegen war.
___________________________________________
Z 2
Ausgangskonstellation:
Anwaltsklausur. Wir waren Beklagtenanwalt. Es gab einen Kläger und zwei Beklagte. B1 war unser Mandant, B2 dessen Kfz-Haftpflichtversicherung. Klage vorm Amtsgericht. Drei Anträge.
1.) Schadensersatz für einen beschädigten PKW (Totalschaden) + Zinsen: 1.700 €
2.) Freistellung von Ansprüchen des Vermieters V: 3.000 €
3.) Freistellung von vorgerichtlichen RA-Kosten: ~229 €
Es soll ein Schreiben ans Gericht gefertigt werden. In dem Fall war ein Schreiben an den Mandanten in jeden Fall entbehrlich. Auch Schreiben an die Versicherung und an den / bzgl des V sind erlassen.
Mandant kommt einen Tag nach Zustellung der Klage zu uns und schildert folgenden Sachverhalt (der im Tatsächlichen unstreitig sein dürfte):
Er habe vor zwei Jahren zusammen mit dem Kläger einen "Garagen-"Parkplatz bei V gemietet (Mietvertrag ist von beiden unterschrieben), der 500 € im Monat kostet. Beide sind "Autobastler" und nutzen den Parkplatz zum Basteln und Schrauben. Eines Tages (13.3.13) habe unser Mandant bemerkt, dass sein privater Wagen nicht mehr zog. Er hat ihn dann in die Garage / Parkplatz verbracht und dort am 16.3. untersucht. Dazu hat er den Motor eingeschaltet und den Wagen vor- und rückwärts bewegt, um besser an bestimmte Stellen des Wagens zu kommen. Er habe dann den Fehler gefunden, behoben und den Motor abgestellt. Der Zündschlüssel blieb stecken. Er wollte eine Probefahrt machen, räumte aber erst noch die Garage auf und wollte noch in die Wohnung um seine Jacke zu holen. Als er die Garage gerade verlassen will, bemerkt er, dass sein Wagen Feuer gefangen hat. Er versucht das mit einem Feuerlöscher zu löschen, was misslingt, weswegen er die Feuerwehr ruft, die den Wagen löscht. Das Feuer hat auch auf das Auto des Klägers übergegriffen, das dadurch einen Totalschaden erlitt (1.700 € Wert).
Der Vermieter musste leider auch die Garage an der Stelle sanieren. Kosten unstreitig 3.000 €.
Der Kläger hat beide Beklagten gemahnt und danach dann einen RA eingeschaltet, der auch beide Beklagten vorgerichtlichlich gemahnt hat.
Dann kommen so Allgemeine Versicherungsbedingungen (AKB) ins Spiel, die zwischen der Beklagten zu 2) und unserem Mandanten gelten. Darin steht u.a., dass die Versicherung den Versicherungsnehmer von Schadensersatzansprüchen freistellt, die "bei Gebrauch" des Kfz entstehen.
Außerdem gibt es ein Sachverständigengutachten aus einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen unseren Mandanten (in dieser Sache; nach § 170 II StPO eingestellt), das sich zur Brandursache verhält. Danach wurde der Brand wegen "Alterung des Materials" verursacht. Dadurch dass der Motor an war, hat sich alles total erhitzt und dann gab's ein explosives Gemisch und hat den Brand verursacht. Allerdings ist der letztlich ursächliche Ablauf erst dann von statten gegangen, als der Motor schon wieder abgestellt war. Ob der Mandant erkennen konnte, dass Ungemach drohte, konnte "nicht mehr festgestellt" werden.
Der Kläger führt in seiner Klageschrift noch aus, der Mandant hätte erkennen können, dass vom Wagen Ungemach drohte. Beweis bietet er nicht an. Auch sei der Wagen "in Betrieb" gewesen, weswegen eine Haftung nach § 7 I StVG bestünde. Dazu trägt er allerhand (u.a.) lustiges vor: So läge "Betrieb" vor, weil er am 13. (also 3 Tage vorher) noch gefahren sei :) Außerdem weil er den Wagen vor und zurück gesetzt habe. Zudem, weil der Zündschlüssel steckte und schließlich weil ja auch in den AKG eine Haftung für "bei Gebrauch" bestehe, wozu ja auch die Reparatur zähle, und das sei ja wie "in Betrieb" zu verstehen. Die Versicherung hafte jedenfalls wegen den AKB.
Der Mandant fragt nun, ob er denn zahlen (und freistellen) müsse. Ihm täte das alles total Leid, aber ihn treffe doch gar keine Schuld. Außerdem wollte er wissen warum der Klägeranwalt so auf dem Begriff "in Betrieb" rumhackt. Auch gegenüber dem V treffe ihn doch keine Schuld. Er will außerdem wissen, ob die B2 auch haftet, und ob er deswegen dann in der Versicherung "hochgestuft" wird. Dann sagt er, er habe während der Sanierungszeit, als die Garage nicht nutzbar war, die Miete weiter voll gezahlt, ob man das nicht dem V entgegen halten ("abziehen") könne.
Ferner habe er mit dem Kläger vereinbart, dass die Miete per Dauerauftrag zunächst von seinem Konto abgebucht wird, dieser ihm dann aber die Hälfte (250,- €) überweist. Das habe auch zwischen Feb. 11 und Juli 12 so geklappt. Dann sei der Kläger arbeitslos geworden. Er habe seit August 12 keinen Cent mehr von der Miete erstattet.
Weil der Kläger ihn nun verklagt, wolle er das Geld "in dem Prozess" wiederhaben. Er fragt, was man da machen könne.
_______________________________________
Z 3
Die Entscheidung des Amtsgerichts Düsseldorf war zu entwerfen. Kläger beruft sich auf Sicherungseigentum an einem PKW, Beklagte ist eine Vertriebsgesellschaft mbH, die im Juli 2011 ein VU über 4.500 € gegen die Tochter/den Schwiegersohn des Klägers erwirkt hat.
Die Tochter kümmert sich um die erkrankte Schwiegermutter. Das findet der Kläger toll und gewährt ihr (und ihrem Mann) im Mai 2011 ein Bar-Darlehen in Höhe von 12.000 € (streitig) zum Erwerb eines Autos (Kauf zum Kaufpreis 11.900 € im Juni 2011), damit die Tochter aus Düsseldorf die Mutter aus Hürth besser erreichen kann. Das ganze soll auf keinen Fall eine Schenkung sein und Rückzahlung der Valuta wird auf den 31.12.2010 bestimmt. Die Tochter bespricht mit ihrem Mann, dass man dem Vater doch eine Sicherheit geben sollte. Sie schickt dem Kläger per Einschreiben den Kfz-Brief samt Schreiben, in dem sie sich nochmal für das Geld bedankt und äußert, dass das Auto dem Vater "gehören" solle (streitig), bis die Eheleute ihm das Geld zurückgezahlt haben. Der Vater erklärt nicht ausdrücklich die Annahme, ist aber einverstanden und behält den Kfz-Brief. Das Schreiben der Tochter ist zwischenzeitlich "futsch".
Am 4. Juni 2013 pfändet der GV das Auto bei den Eheleuten zur Vollstreckung des VU. Die GV kündigt am 5.6. an, dass die Versteigerung auf den 1.8. terminiert ist, sollten die 4.500 € nicht bis dahin beglichen werden. Der Kläger-RA schreibt am 12.6. unter Vorlage einer e.V. von sich und seiner Tochter und widerspricht der Pfändung und der Verwertung. Nachdem nichts passiert, erhebt er im Juli 2013 Drittwiderspruchsklage. Am 5.8. teilt der Beklagten-RA mit, dass inzwischen das Auto versteigert ist (4.650 €) und 4.000 € an die Bekl. ausgekehrt worden sei.
Der Kläger stellt daraufhin seinen Klageantrag auf Zahlung des Erlöses + Schadensersatz (insg. 6.000 €) um. Das Auto hat unstreitig einen solchen Zeitwert gehabt.
Die Beklagte rügt nun die Zuständigkeit des Gerichts (6.000 € sei doch eine Sache für das LG). Außerdem sei die Übereignung, so sie denn überhaupt stattgefunden habe, als Scheingeschäft nichtig, da die Eheleute doch eigentlich nur Vermögensmasse beiseite schaffen wollte. Jedenfalls sei die Übereignung auch nicht durch Übergabe des Kfz-Briefs erfolgt. Außerdem erklärt er die Anfechtung wegen Gläubigerbenachteiligung nach dem AnfG. Ferner verstieße das Ganze gegen Treu und Glauben. Immerhin habe der Kläger die Valuta bis heute nicht zurückgefordert. Dem Kläger ginge es doch gar nicht um seine eigenen Interessen sondern nur darum, den Eheleuten den Wagen bzw. die Surrogate zu verschaffen. Schließlich trage der Kläger aber ein überwiegendes Verschulden daran, dass der Wagen "unter Wert" versteigert wurde. Er hätte ja einen Vollstreckungsschutzantrag stellen können.
Der Kläger repliziert u.a., dass er sehr wohl ein Interesse habe. Schließlich ginge es ihm nun nicht mehr darum, den "Kindern" das Auto zu erhalten, sondern er wolle nun selbst vom Wert des Wagens (der ja schließlich der Sicherung seines Darlehens diente) partizipieren. Er habe das Darlehen aufgrund der familiären Verbundenheit bisher nicht zurückgefordert.
Die Beklagte schreibt darauf nicht mehr.
Das Gericht erhebt Beweis durch Vernehmung der Eheleute.
Die Tochter bestätigt den Erhalt und den Zweck des Geldes. Man habe das Auto auch mit diesen Mitteln gekauft. An das alles könne sie sich u.a. auch noch deshalb erinnern, da der Kläger ihr das Geld an ihrem Geburtstag im Mai in Aussicht gestellt habe. Es sei klar gewesen, dass dem keine Schenkung zugrunde liege, sondern der Kläger das Geld zurückerhalten sollte. Sie habe dann mit ihrem Mann besprochen, dass man den Kläger "absichern" solle und den Kfz-Brief per Einschreiben an den Kläger versandt. Sie habe sich bedankt und dabei geschrieben, dass das Auto "dem Vater gehören" solle bis das Geld zurückgezahlt sei.
Der Ehemann bestätigt das alles. Er habe das Schreiben zwar nicht selbst gelesen, aber seine Frau habe es ihm bei der Arbeit am Telefon vorgelesen. Für ihn sei das so gewesen, wie wenn die Bank einen Kredit gibt und man ihr dann dafür Sicherheiten gibt. So sei das ja auch hier. Der Kläger sei die Bank und das Auto diene nun seiner Absicherung.
_____________________________________
Z 4
Anwaltsklausur. Klage vorm Landgericht Düsseldorf (definitiv ;) kein Aktenzeichen im Aktenauszug). Wir waren Anwalt der Beklagten, einer GmbH aus D'Dorf. Die Klägerin war eine GmbH & Co. KG aus Aachen.
Die Klägerin verkauft Autos an diverse Kunden. Die Beklagte ist eine Leasinggesellschaft, die in die Kaufverträge mit Zustimmung der Kunden eintritt und die Autos dann an die Kunden "verleast". Die Klägerin und die Beklagte machen das, insb. mit dem Kunden H (AG), schon seit vielen Jahren so.
Drei Anträge:
1.) Zahlung von 65.000 € aufgrund der Kaufverträge zzgl. Zinsen (8-%-Punkte)
2.) Rechtsanwaltskosten als Verzugsschaden (ca. 1.800 €)
3.) Feststellung, dass die Klägerin nicht verpflichtet ist, aus einer Rückkaufvereinbarung an die Beklagte zu zahlen.
Zum Sachverhalt im Übrigen:
Der Klageantrag zu 1) stützt sich auf Kaufverträge, in die die Beklagte - wie üblich - "beigetreten" ist. Dem Grunde nach ist der Anspruch auch unstreitig.
Die Klägerin forderte die Beklagte zur Zahlung auf. Die Beklagte weigert sich zu zahlen, da die Klägerin ihr noch einen Betrag in Höhe von 110.000 € schulde.
Dazu trägt die Beklagte wie folgt vor:
Beim Beitritt in die Kaufverträge schließt sie mit der Klägerin "Rückkaufvereinbarungen". Danach soll nach 24 Monaten die Klägerin verpflichtet sein, die Wagen - die die Bekl. bis dato pflegt - zu einem Prozentsatz von 46% des Restwertes zurückzukaufen, wenn er 100.000 km gelaufen ist. In den Bedingungen des "Rückkaufvertrages" ist u.a. auch geregelt, wie der Preis sich ändert, wenn der Wagen früher oder später zurückgegeben wird oder wenn er mehr oder weniger km gelaufen ist.
Die Bekl. sagt im Mandantengespräch u.a. auch noch, dass dieses Spielchen schon seit vielen Jahren so gespeilt werde, aber auch nur bei Geschäften unter Beteiligung der H-AG. Bei anderen Kunden gäbe es diese RÜckkaufvereinbarung nicht. Die H-AG und die Klägerin hätten diese 46% Regelung -so glaubt die Bekl. - auch schon vorher getroffen gehabt. Ferner lege die Kl. die Restwerte fest. Sie kenne sich damit ja auch viel besser aus.
Davon würden ja alle drei Parteien auch toll profitieren. Die Klägerin inbesondere deshalb, weil sie gepflegte Autos zurückerhalte. Aber auch, weil sie durch die Geschäfte mit der H-AG (die i.Ü. Stein des Anstoßes ist, weil sie den Verkäufer der Autos bestimmt und so die Kl. gewählt hat; nun aber in Zukunft den Verkäufer wechseln will) Millionenbeträge einnehme (die kaufen wohl jährlich an die 100 Autos für ihre Flotte).
Aus diesem Geschäft stünde ihr nun wegen 9 Rückkaufverpflichtungen ein Betrag in Höhe von 110.000 € zu (Höhe unbestr.). Damit hat sie dann auch vorprozessual die Aufrechnung erklärt, nachdem sie sich zuvor geweigert hatte, die 65.000 € zu begleichen, ehe nicht die 110.000 € bezahlt sind (ZbR?!)
Die Klägerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die Aufrechnung nicht zöge, weil sie ja in den Neuwagen Verkaufsbedingungen die Aufrechnung ausgeschlossen habe. In diesen Bedingungen ist die Aufrechnung "§ 309 Nr 3 BGB-konform" ausgeschlossen. Ferner ist das ZbR ausgeschlossen. (Außerdem ist als Gerichtsstand der Sitz der Klägerin ausgewiesen. Die Klage ist trotzdem in Düsseldorf anhängig).
Außerdem sei auch die Rückkaufvereinbarung unwirksam. Diese sei ja schließlich eine AGB, da sie von der Bekl. einseitig gestellt würden (sie legt eine exemplarische Beitrittserklärung "unter Vorbehalt der Unterzeichnung der Rückkaufvereinbarung" vor sowie die Rückkaufvereinbarung exemplarisch). Ferner sei darin ja nur ein Angebot und kein Vertragsschluss zu sehen. Insbesondere sei das ja auch wegen der "dynamischen Preise" keine Bedingung nach § 158 BGB und auch keine Option. Weiter sei aber auch die Annahmefrist nach § 307, 147 II BGB unangemessen lang, sie betrüge ja 24 Monate. Zudem sei die Berechnung des Rückkaufpreises für sie intransparent, und das Äquivalenzinteresse sei gestört. Außerdem widerspreche das alles auch der vertraglichen Risikoverteilung.
Nach der Abwrack-Prämie in 2009 seien auch die Gebrauchtwagenpreise drastisch eingebrochen (mind. 6%, Tendenz steigend - unstr.).
Der Antrag zu 2) sei begründet, da die Bekl. ja schließlich in Verzug sei ((a)Zahlungsaufforderung durch Kl. - (b) Weigerung unter Verweis auf offene 110.000 € durch Bekl.: Zahl bis Tag X. © Kl. widerspricht und fordert nun ihrerseits zur Zahlung bis Tag Y auf. (d) Bekl. erklärt die Aufrechnung. (e) Kl. beauftragt RA, der nun die Bekl. mahnt).
Die Mandantin möchte nun wissen, ob es sich lohnt, sich gegen die Klage zu verteidigen und wie bzgl. der Gegenforderung zu verfahren sei.
___________________________________________
S 1
Es gab einen Beschuldigten A, 20 Jahre alt und einmal wegen KV und Diebstahl vorbestraft (4 Wo. Jugendarrest), und einen gesondert Verfolgten S. Zu begutachten ist nur A. Ebenfalls soll nur bzgl. A die Entschließung der StA angefertigt werden. Der S ist chronisch pleite, hat 50.000 Euro Schulden und verdient 1.000 Euro im Monat. Der A, der das alles weiß (sagt jedenfalls der S im Rahmen eines allumfassenden Geständnisses nach ordnungsgemäßer Belehrung) arbeitet in der Kreditvergabe bei einer Bank. Der S fragt, wie viel er wohl verdienen muss, um einen Kredit in Höhe von 75.000 Euro zu bekommen. Der A berechnet ihm das mit 4.000 Euro.
Nun kündigt S ggü A an, er werde seine Gehaltsbescheinigungen beschönigen und aus den 1.000 mal 4.000 € machen. Gesagt getan. A gibt nun die Daten in das Kreditvergabeprogramm der Bank ein. Das Programm funktioniert so, dass es voll automatisiert die Daten zugrunde legt und prüft, ob ein Kredit vergeben werden kann oder nicht. Wenn der Antragsteller den Kredit voraussichtlich zurückzahlen kann, ist das ein "Grünfall". Dann wird der Kredit automatisch vom Programm genehmigt und das Geld automatisch ausgezahlt. Bei einem "Gelbfall" setzt sich nochmal ein Mitarbeiter an den Antrag und bei einem "Rotfall" gibt's die Ablehnung bereits vor Ort. Durch die Manipulation der Daten liegt nun ein "Grünfall" vor, statt, wie bei 1000 €, ein Rotfall. A soll für seine "Dienste" vom S 5.000 € bekommen, die bisher aber nicht ausgezahlt wurden. S lässt sich u.a. noch dahingehend ein, dass er das Geld nie hätte zurückzahlen können und wollen (was A auch wissen dürfte). Die Unterlagen, die der Kreditvergabe zugrundeliegen, werden von der Verwaltung gesammelt.
Das Geld wird ausgezahlt. Der Bank fällt eine Ungereimtheit auf und es kommt zur Strafanzeige. Es ergeht ein Durchsuchungsbeschluss (alles ordnungsgemäß laut Hinweis LJPA), der sich auf die in der Whg des A befindlichen Sachen, einschließlich PC erstreckt. Bei der Durchsuchung finden die Ermittlungsbeamten der Polizei auf dem Schreibtisch ein mit "Zahlungsaufforderung" überschriebenes "Erpresserschreiben", dass an die Bank adressiert und als "Entwurf" gekennzeichnet ist. Darin droht der Verfasser an, das Onlinebanking Portal der Bank lahmzulegen, wenn man ihm nicht zu einer näher zu bestimmenden Zeit 50.000 Euro zahlen werde. Außerdem findet die Polizei auf dem PC eine Software, die durch das LKA als Schadsoftware (DoS-Angriff) begutachtet wird, die das Portal der Bank durchaus für mehrere Stunden lahmlegen kann. Als man diese gerade gefunden hat, taucht A plötzlich von hinten auf und sagt, er habe die Software als Computerfan hergestellt, das sei ja wohl nicht strafbar. Dann sei er wieder gegangen. Man habe Schreiben und Software (ordnungsgemäß) beschlagnahmt.
Der Wahlverteidiger des A widerspricht der Verwertung von Schreiben und Software. Die Sachen seien vom Durchsuchungsbeschluss nicht umfasst gewesen (Zufallsfund).
____________________________
S 2
Urteilsklausur. Drei Angeklagte. Kostenentscheidung ebenso erlassen wie die Feststellungen zur Person; auch ein Haftfortdauerbeschluss und auch ein etwaiger Bewährungsbeschluss waren nicht anzufertigen. Im Übrigen die üblichen Bearbeitervermerke, insb. zur Strafzumessung. Strafanträge waren gestellt und alle Aussagegenehmigungen und Belehrungen etc. lagen vor.
Die Straftatbestände der §§ 123, 164, 180, 180a, 323c StGB waren erlassen.
Tatvorwürfe aus dem Bereich der Tötungsdelikte, dazu später mehr.
Zu den Protagonisten:
Der Angeklagte M. ist im Rotlichtmilieu tätig. Hierüber kennt er auch den Angeklagten Herrn A (A). Die Angeklagte Frau A (F), die Ehefrau des A, ist die Tochter des verstorbenen Lebensgefährten des Opfers sowie deren testamentarische Alleinerbin. Das Opfer war 77 Jahre alt und wohnte alleine in einem Mehrfamilienhaus (10 Einheiten).
Die Anklagevorwürfe:
M und A sind wegen gemeinschaftlichen Mordes aus Habgier sowie gemeinschaftlichen Raubes angeklagt.
Die F wegen Beihilfe zum Mord aus Habgier.
Alle drei sitzen auch brav in Haft (alles ordnungsgemäß erlassen).
Der Sachverhalt:
Der A betreibt einen Bordellbetrieb und vermietet zu dem Zweck Wohnungen in einem ihm gehörenden Haus an Prostituierte. Der M überwacht diese. Das ganze rentiert sich aber nicht und A kann einen Kredit für dieses Haus daher nicht ordentlich bedienen. Die F fordert ihn auf, das Haus zu verkaufen und auch das Opfer (O) stellt sich auf die Seite der F. Darüber ist A erbost und im Stolz gekränkt. Er ist außerdem sauer, dass die O i.wann mal bei i.einem PKW-Verkauf nicht so gehandelt hat wie das zwischen A und O abgesprochen war. Er spielt mit dem Gedanken, die von ihm als vermögend bekannte O zu "beseitigen". Das war Mitte 2012. Januar 2013 wendet er sich dann an den M und bietet ihm 23.000 € für die Tötung an und zudem darf M sich an dem Schmuck der O bereichern. M geht drauf ein und A weist ihn nun darauf hin, wie O heißt, wo sie wohnt und wo der Schmuck versteckt ist. Außerdem fährt er auch mal gemeinsam mit M zu dem Haus. Schließlich gibt er ihm am 14.3. den Tipp, dass O am 16.3. allein zuhause ist.
M fährt am 16.3. zu der Wohnung, und trifft in der Diele auf O, die schreit. Er schlägt sie und erwürgt sie schließlich. I.wann währenddessen oder danach sammelt er den Schmuck zusammen. Beim Verlassen, O ist bereits tot und ihr wurde bei der Würgeattacke auch das Zungenbein gebrochen, hebt er vom Boden ein Mobiltelefon der O auf und steckt es ein.
Der A ruft am Folgetag die Polizei zu der Leiche. Das Handy wird nach 10 Tagen mit einer dem M zuzuordnenden Telefonnummer geortet und ein Anruf mit A wird festgestellt. Als die Polizeibeamten zu dem Haus des A und der F fahren und klingeln, öffnet F und schreit dann den A an, "ich hab doch gesagt, du sollst das lassen. Das hast Du nun von Deiner Geldgier und Deinem Stolz". Beide werden festgenommen.
Die F sagt nichts aus. Der A - ordnungsgemäß belehrt - verzichtet auf einen Verteidiger und erzählt den Beamten erstmal einen vom Pferd. Nach mehreren Stunden (das Verhör dauert insg. fast 8 Stunden) räumt er den Tatvorwurf (wie oben beschrieben) ein, sagt aber, er habe M den Schlüssel nicht gegeben und er wisse auch nicht wie M die Tat begangen habe und mit wem.
Der M "gesteht" auch die Vorgeschichte meint aber, er habe O nie töten wollen. Er wollte den A nur um die 23.000 € erleichtern und den Schmuck haben. Er habe den Bekannten "Sunny" aus Belgien kontaktiert, der 20-30 J. alt sei, 180 cm groß, dunkle Haare, und ihm von dem Plan erzählt. Gemeinsam mit "Sunny", dessen augenblicklichen Aufenthaltsort er nicht kenne und der auch nicht ermittelt werden konnte, habe er die Diele betreten. Als O geschrien habe, habe er ihr einen Schlag gegen den Mund versetzt. Der Sunny habe sich dann weiter um sie gekümmert und er, also M, habe den Schmuck (Wert 12.000 €) zusammengesucht. Als er die Whg verlassen habe, sei O noch am Leben gewesen. Das habe er gesehen, denn die Augen hätten sich bewegt. Dann habe er das Handy eingesteckt.
Auf der Leiche wurden DNA Spuren sichergestellt, ebenso an den Schränken. Diese stammten von einer männlichen Person. Weitere DNA Spuren gab es nicht, insb. nicht von einer weiteren Person. Diese befanden sich u.a. auch am Hals der O. Die Eingangstür war laut KTU Bericht unversehrt und auch die Fenster waren in Ordnung und verschlossen.
Die DNA stammte von M.
A sagte noch, dass er seiner Frau ggü sein Vorhaben angedeutet habe. Diese habe ihn aufgefordert davon Abstand zu nehmen. Er, A, habe aber darauf vertraut, dass F ihn schon nicht anzeigen werde. Außerdem habe er damit gerechnet, dass F das Erbe, das er vermutete, mit ihm teilen werde.
M sagte zu Fs Wissen befragt aus, dass er dazu nichts genaues wisse. Ihm sei nur wichtig gewesen, dass keine Anzeige drohe. Zu den Erbbeteiligungen wisse er nichts. Das sei ihm aber auch egal gewesen.
Vor Gericht:
A und F sagen nicht aus, von M wird durch den Anwalt eine Einlassung (s.o.) verlesen. Dann werden die Polizeibeamten vernommen und bestätigen die Aussagen des A und der F vor Ort.
Der Verteidiger des A widerspricht der Verwertung der Aussage zu der Einlassung des A. Dieser sei ermüdet gewesen bei der Vernehmung. Das können die Zeugen nicht bestätigen. Es habe keine ANzeichen dafür gegeben, A habe auch nichts dahingehend verlautbart. Außerdem habe er zwischen 0:45 Uhr und 7:00 Uhr im Haftraum geschlafen; man habe ihn jedenfalls um 7:00 Uhr geweckt und auch erst um 11:00 Uhr in den Vernehmungsraum verbracht.
Der Verteidiger der F widerspricht zudem der Äußerung der F damals an der Tür (Spontanäußerung).
Außerdem erstatten die drei Sachverständigen ihre Gutachten (Todesursache und Verletzungen; Zustand der Wohnung / Türen / Fenster; DNA)
________________________________________________
V 1
Einstweiliger Rechtsschutz, Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage gegen einen Rückforderungsbescheid in Gestalt eines Widerspruchbescheides.
Der Antragsteller (Ast) wendet sich gegen die BRD, vertreten durch das BMVg, vertreten durch das BVA. Dieses will vom ihm ca. 2.300 € zurückhaben, die sie, die Antragsgegnerin (Ag), zu viel an den Ast. gezahlt hat.
Unser Ast. ist Berufssoldat der Bundeswehr. Er hat einen Hauptschulabschluss, eine abgeschlossene Ausbildung als Dreher und ein Staatsexamen als Rettungsassistent. Seit 2006 ist er bei den "Fliegern" aktiv und erhält aufgrund eines Bewilligungsbescheides aus 2006 eine Zulage nach einer Anlage zur Besoldungsordnung zum BBesG. Diese sieht vier Kategorien vor. Drei für Flugzeugführer und eine für sonst. selbständige Luftfahrzeugangehörige. Unser Ast. gehört nach der Bewilligung in die letztgenannte Klasse (ca. 290 €), bei der es auch am wenigsten Zulage gibt. Im Jahr 2011 vertippt sich ein Mitarbeiter des BVA und seither bekommt der Ast. eine höhere Zulage (ca. 360 €), obschon er weiterhin der Kat. 4 angehört. Im August 2013 wird er versetzt und ist grds. nicht mehr zulagenberechtigt, sofern nicht eine Ausnahmeregelung aus der Anlage zum BBesG greift. Das BVA prüft, ob diese Ausnahme vorliegt und entdeckt den Fehler, der dem Ast. zwischen 2011 und Mitte 2013 ein Plus von knapp 2.300 € beschert hat. Mit der "richtigen" Zulage verdient er ca. 2.780 €, mit der "falschen" ca. 2.850 €. Das wird durch Gehaltsbescheinigungen ausgewiesen. Diese sind zudem nach den jeweiligen Bezügeposten (Gehalt, Zulage A, B, C, ... etc.) aufgeschlüsselt, wobei in den alten Bescheinigungen "Zulage Flieg Personal (IV) aktiv" steht und in den neuen "Zulage Flieg Personal (II) aktiv, rgf" steht.
Man hört den Ast. an und erlässt dann einen Rückforderungsbescheid mit ASV. Der Ast. erhebt dagegen Widerspruch und es ergeht ein bestätigender Widerspruchsbescheid. Der Ast. erhebt nach 10 Tagen Klage und stellt den hiesigen Antrag.
Inhaltlich trägt die Ag. vor, dem Ast. hätte der Fehler auffallen und er hätte ihn melden müssen. Er könne sich auch nicht, wie es der Ast. im Widerspruch macht, auf Entreicherung berufen, da dies nur bei Luxusaufwendungen möglich sei. Nicht jedoch sei dies bei Aufwendungen zur Verbesserung des Lebensstandards möglich. Die ASV begründete man mit dem "öffentlichen Interesse an der Rückzahlung zuviel gezahlter Beträge" und der "offensichtlichen Rechtmäßigkeit des Rückforderungsbescheides".
Im Verfahren trägt der Ast. vor, dass die ASV nicht ausreichend begründet sei und der Antrag schon allein deshalb voll Erfolg haben müsse. Jedenfalls sei der VA aber rechtswidrig und er in seinen Rechten verletzt. Denn der VA sei schon zu unbestimmt, da sich nicht ergebe, wie sich der Rückforderungsbetrag rechnerisch zusammensetze. Jedenfalls stellten aber die ihm übermittelten Gehaltsbescheinigungen einen Rechtsgrund zum Behaltendürfen dar. Auch sei er ja entreichert, auch wenn er nicht mehr genau nachweisen könne, wofür er die Aufwendungen getätigt habe. Auch Aufwendungen zur Verbesserung des Lebensstandards könnten zu Entreicherung führen. Der Lebensstandard richte sich nach den Bezügen. Jedenfalls sei der Fehler aber für ihn, zumal er nur über einen Hauptschulabschluss und eine Ausbildung zum Dreher verfüge, nicht erkennbar gewesen. Die Gehaltsbescheinigungen seien verwirrend und abschreckend gewesen. Auch trage die Ag. ein erhebliches Mitverschulden und er beruft sich auf die Einrede der Verjährung.
Die Ag. trägt vor, dass die ASV sehr wohl ausreichend begründet sei, jedenfalls könne das dem Antrag aber nicht zum Vollerfolg verhelfen. Sie legt vor der Entscheidung eine Tabelle vor, in der Erhaltene und Zustehende Beträge gegenübergestellt werden (für alle Monate) und am Ende die Differenz ausgewiesen wird. Damit sei ein etwaiger Fehler doch nun geheilt. Die Gehaltsbescheinigungen seien keine VAe und damit kein Rechtsgrund im Sinne des § 812 BGB. Der Ast. könne sich auch nicht auf Entreicherung berufen. Auch war der Fehler für ihn erkennbar, und zwar durch einen simplen Vergleich der Bescheinigungen, und es sei ja sowieso auf die Kenntnis des Empfängers abzustellen. Wenn sie überhaupt ein Mitverschulden treffe, sei das jedenfalls nur auf leichter Fahrlässigkeit begründet und das Mitverschulden des Ast. überwiege. Auch aus Billigkeitsgesichtsgründen stünde dem Ast. das Geld nicht zu. Letztlich läge zudem weder ein Fall von Verwirkung noch von Verjährung vor.
Laut Bearbeitervermerk war der Streitwertbeschluss erlassen. Im Falle der Unzulässigkeit war ein Hilfsgutachten gefordert und es sollte "in jedem Falle" auf die Rechtmäßigkeit des Rückforderungsbescheides eingegangen werden. Die Entscheidung sollte am 14.11.2013 ergehen, während die Sitzung am 13.11.2013 stattfand.
Die Ermächtigungsgrundlage war in den Bescheiden angegeben: § 12 II 1 BBesG i.V.m. §§ 812 ff. BGB.
________________________________________________
V 2
Es war eine Anwaltsklausur. Wir waren Vertreter des Privaten/Anspruchstellers.
Unsere Mandantin ist eine große Zirkus GmbH. Diese zieht jährlich quer durch die Republik. Sie legt dabei die Tournee-Halte so, dass sie möglichst schnell und kostengünstig von Ort A nach Ort B und so weiter kommt. Zu ihrem Reportoire gehören neben Auftritten mit Haustieren auch solche mit "exotischen Tieren". Sie verfügt des Weiteren über eine Erlaubnis nach § 11 I 1 Nr. 3d TierSchG (nunmehr Nr. 8d).
Die Stadt vergibt einen Veranstaltungsplatz (um den es später gehen wird) regelmäßig auf dem Wege, dass sie in einem ersten Schritt die Genehmigung (durch öff.-rechtlichen Vertrag) vergibt und das "Wie" durch privatrechtlichen Vertrag regelt.
Im Januar und nochmal konkreter im März 2013 beantragt sie bei der Stadt Bonn, unserer Antragsgegnerin, die Zulassung zu einem Platz in Bonn (vor der Beethovenhalle), wo sie den Zirkus stattfinden lassen kann. Sie gibt den Zeitraum mit Mitte März bis Mitte April 2014 an. Ferner reicht sie ein Programmheft bei, aus dem hervorgeht, dass die M auch Auftritte mit Exoten im Reportoire hat. Die Stadt schreibt darauf im Mai sinngemäß, dass auf die Anfrage aus dem März die Mandantin nunmehr für ihr Gastspiel "für den Zeitraum Mitte März bis Mitte April 2014 vorgesehen" sei. Sie solle die konkreteren Planungen mitteilen. Das macht M und gibt den Zeitraum 14.3. bis 28.3.14 an (ein Tag Auf- und Abbau eingerechnet, das eigentliche Gastspiel dauert 12 Tage). Dann passiert lange nichts. Im September verweist die Stadt auf einen inzwischen ergangenen (formell rechtmäßigen) Ratsbeschluss, der "im Namen des Tierschutzes" vorsieht, dass Bewerber bestimmte Unterlagen (die auch im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach § 11 TierSchG eine Rolle spielen) vorgezeigt werden, bevor der "Ob"-Vertrag geschlossen werden darf. Außerdem seien Wildtiere / Exoten fortan auszuschließen. Das sei aus Gründen des Tierschutzes geboten.
Unsere M (aus München) schaltet einen RA in München ein, der der Stadt schreibt, dass er den Ratsbeschluss für rechtswidrig hält. Es gebe keine Ermächtigungsgrundlage und die Stadt sei ja für Tierschutzangelegenheiten auch gar nicht zuständig. Ferner verstieße das Verbot von Exoten gegen das TierSchG. Die Stadt erwidert, dass sie an den Ratsbeschluss gebunden sei und das ja auch alles rechtmäßiger weise dem TierSchutz diene.
Die M will eine schnelle Lösung (lt. BV würde ein "Normales" Verfahren auch nicht vor Mai 2014 zu einer Entscheidung führen). Sie meint, dass in der ersten Mail der Stadt eine verbindliche Zusage zu sehen sei. Fortan habe sich auch die Sach- und Rechtslage nicht mehr geändert. Hilfsweise habe sie einen Zulassungsanspruch aus § 8 GO NRW. Sie legt noch eine eidesstattliche Versicherung vor, wonach kein Ausweichort vorhanden sei und sie mit Einnahmen von Rund 880.000 € für die 12 Tage rechnen könne. Ferner habe sie Fixkosten in Höhe von rund 360.000 €.
11.11.2018, 13:58
Hallo zusammen!
Gibt es zur Klausur Z II irgendwo eine Diskussion zu finden?
Gibt es zur Klausur Z II irgendwo eine Diskussion zu finden?